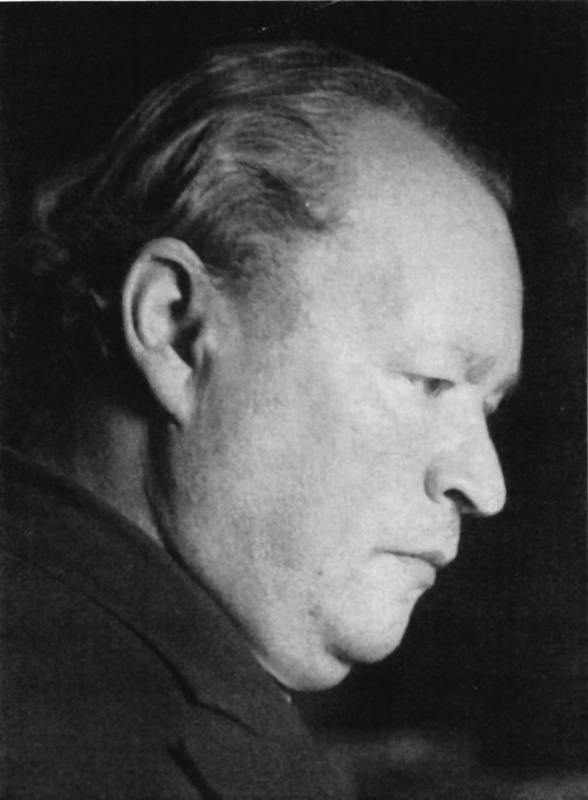Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 250.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 133.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007.
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 133.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959.
GEBURT
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 415.
TOD
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 675 ff.
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 60.
RELIGION
jüdisch
Er war zeitweise Religionslehrer an Berliner Schulen, Privatlehrer, Chorleiter in der Synagoge am Fraenkelufer, zudem tätig in der Alten Synagoge (ab 1931), Synagoge Pestalozzistraße, Synagoge Münchner Straße.
„Nach den Erinnerungen der Nichte Frau Metz (s. Archiv BJ Ffm) war A N ziemlich frei erzogen, hing am Judentum auf seine persönliche Art, hielt auch den Schabbat auf seine Art. [...] Seine Religion hat er sich selbst zurechtgemacht.“
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
FAMILIE
Ehe
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Kinder
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Eltern
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 10 ff.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 250.
Geschwister
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009.
PERSÖNLICHES
Wohnorte
Bamberger Straße 37, Berlin-Schöneberg
Nettelbeckstraße – Berlin (bis 1941)
Bamberger Straße 57, Berlin-Wilmersdorf
Häufig frequentierte Orte
BILDUNGSWEG
Schule
Schulbesuch in Königsberg
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 132 f.
Ausbildung
Ausbildung in jüdisch-liturgischer Musik (1890 – 1895)
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008.
Lehrerausbildung (1895 – 1900)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Nemtsov, Jascha: Der Zionismus in der Musik. Jüdische Musik und nationale Idee. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2009, S. 64.
Sprachkenntnisse
Hebräisch
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 416.
Jiddisch
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 416.
Polnisch
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 416.
Russisch
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 416.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
„Singerl“ im Chor von Eduard Birnbaum (1890 – 1895)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 250.
Musikpublizist für verschiedene Berliner Zeitschriften und Zeitungen (ab 1903)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 252.
Nemtsov, Jascha: Der Zionismus in der Musik. Jüdische Musik und nationale Idee. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2009.
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 133.
Chordirigent der Berliner Jüdischen Gemeinde an der Kottbusser Synagoge (1916 – ca. 1930/1931)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Kantor an verschiedenen Berliner Synagogen (ab 1916)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Erstellen des „Kompendium Hallelujah! Gesänge für den jüd. Gottesdienst. Zugleich eine systematische Auswahl bedeutender Synagogenkomponisten“ (1922 – 1938)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Anfertigen von Portraits (ab ca. 1933/1934)
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 141.
Referent der Berliner Monatsschrift Die Musik (bis 1941)
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, S. 945.
Chordirigent und Organist auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee (bis 09.1941)
Zahn, Christine: „Wer den Maler Arno Nadel noch nicht kennt, weiß von dem Dichter und findet in ihm den Musiker wieder“. In: Juden in Kreuzberg. Fundstücke, Fragmente, Erinnerungen. Berlin: Ed. Hentrich 1991, S. 299–304.
Privatlehrer für Musik, Kunstgeschichte, Literatur und Religionslehrer an Berliner Schulen
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 691.
MITGLIEDSCHAFTEN
Kulturbund deutscher Juden (01.07.1933 – 11.09.1941)
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 134 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Grubel, Fred: Schreib das auf eine Tafel die mit ihnen bleibt. Jüdisches Leben im 20. Jahrhundert. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 1998, S. 309.
KONTAKTE
Drees, Stefan: Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker. Sources relating to the History of Emigré Musicians 1933–1950, I Kalifornien / California. Herausgegeben von Schwartz, Manuela/Weber, Horst. München: Saur 2003, S. 171, 184.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 434.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 141.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 133.
Ohne Autor: Arno Nadel - lost and forgotten. In: Association of Jewish Refugees in Great Britain (Hrsg.): AJR Information, Vol. XIII, Nr. 10 (Oktober 1958) London: Langley & Sons LTD, S. 12, hier: S. 12.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 445.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Drees, Stefan: Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker. Sources relating to the History of Emigré Musicians 1933–1950, I Kalifornien / California. Herausgegeben von Schwartz, Manuela/Weber, Horst. München: Saur 2003, S. 171, 184.
Drees, Stefan: Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker. Sources relating to the History of Emigré Musicians 1933–1950, I Kalifornien / California. Herausgegeben von Schwartz, Manuela/Weber, Horst. München: Saur 2003, S. 171, 184.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 678.
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 60.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 444 f.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 451.
Richter, Neela: „Dem Heute geben, was des Heute ist.“ Karl Escher, Journalist und Schriftsteller (1885–1972). Ein Leben. 2008, S. 40.
VERANSTALTUNGEN
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 284.
R. M.: Kulturbundführung im Atelie von Arno Nadel. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 40, Nr. 31/32 (17.04.1935) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 53, hier: S. 53.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 421.
Ohne Autor: Aus Kunst und Wissenschaft. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 38, Nr. 92 (17.11.1933) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 825, hier: S. 825.
L. A.: Arno Nadel über das jüdische Volkslied. In: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V. (Hg.): C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum. Allgemeine Zeitung des Judentums, Jg. 12, Nr. 44 (16.11.1933) Berlin: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V, S. 6, hier: S. 6.
L. A.: Jüdisches Leben - jüdischer Geist. Arno Nadel: Merkmale jüdischer Musik. In: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V./Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V., Berlin (Hg.): C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Jg. 15, Nr. 5 (30.01.1936) Berlin: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V.
Ohne Autor: Ankündigungen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 42, Nr. 3 (12.01.1937) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 10, hier: S. 10.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Lola Braunstein: Das kleine Ich. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 4.
George A. Goldschlag: Eines Nachts im Schützengraben. In: Der Schild. Zeitschrift des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten E.V., Berlin, 13. Jg., Nr. 35 vom 14. September 1934, S. 2.
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Else Lasker-Schüler: Ein Lied an Gott. In: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, Berlin, 58. Jg., Nr. 46 vom 27. Januar 1929.
Paul Mayer: Spruch. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 6.
Jakob Picard: Der Ruf. Eine Anekdote. In: Der Morgen. Monatsschrift der deutschen Juden, Berlin, 11. Jg., Nr. 3 vom Juni 1935, S. 117–118.
Jakob Picard: Der Ruf. Eine Anekdote. In: Der Morgen. Monatsschrift der deutschen Juden, Berlin, 11. Jg., Nr. 3 vom Juni 1935, S. 117–118.
Jakob Picard: Der Ruf. 1936.
Jakob Picard: Der Ruf. In: Blätter des Jüdischen Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung, Berlin, 12. Jg., Nr. 6 vom Juni 1936, S. 5–6.
Moriz Seeler: Betrachten einer alten Seekarte.
Manfred Sturmann: Die Saat.
Manfred Sturmann: Die Siedler. 1935.
Franz Werfel: Ezechiels Gesicht von der Auferstehung. 1935.
Franz Werfel: Mysterium der Auserwählung. 1935.
R. M.: Jüdische Dichter in dieser Zeit. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 50 (24.06.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 12.
Arno Nadel: Abraham oder: Die Entdeckung Gottes. 1920, 8 S.
Arno Nadel: Der Gast. 1914, 1 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 103 S.
Arno Nadel: Jona. 1920, 17 S.
Arno Nadel: Kein Zurück. 1914, 1 S.
Arno Nadel: Mitgefühl. 1914, 1 S.
Arno Nadel: Nach manchem Tag. 1914, 1 S.
Arno Nadel: Regentag. 1914, 1 S.
Arno Nadel: Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S.
R. M.: Vorlesung Arno Nadel. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 40, Nr. 100 (13.12.1935) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 21, hier: S. 21.
Ohne Autor: Ankündigungen. Herta Reiss. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 41 (24.05.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 9, hier: S. 9.
Arno Nadel: Kulturbundaufführung „Jeremias“ von Stefan Zweig. Vom 07. Oktober 1934.
Stefan Zweig: Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern. Leipzig: Insel Verlag Anton Kippenberg 1917, 216 S.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 421.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 385.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 141.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 141.
Ausstellung „Berliner jüdische Künstler auf Reisen“ des Sekretariats für bildende im Klubheim des Jüdischen Fraunebundes, Marburger Str. 5. 1937.
Schlesinger, H. (Ruth Morold): Berliner jüdische Künstler auf Reisen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 42, Nr. 98 (10.12.1937) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 14, hier: S. 14.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 401.
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 401.
Arno Nadel: Der Ton. Die Lehre von Gott und Leben. Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 734 S.
Arno Nadel: Jona. 1920, 17 S.
Ohne Autor: Arno Nadel – Sein Werk in Bild und Wort. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 6 (21.01.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 15, hier: S. 15.
Weltmann, Lutz: Arno Nadel in Bild und Wort. In: Israelitisches Familienblatt, Jg. 40, Nr. 11 (17.03.1938), S. 3, hier: S. 3.
Hilde Marx: Dreiklang. Worte von Gott, von Liebe, vom Tag. Berlin: Philo GmbH – Jüdischer Buchverlag und Buchvertrieb 1935, 71 S.
Arno Nadel: Rahels Tod. 1920, 18 S.
Arthur Silbergleit: Der ewige Tag. Gedichte. Herausgegeben von Künstlerhilfe der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Berlin: Berthold Levy Verlag 1935, 31 S.
Arthur Silbergleit: Moses Tod. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 7 vom 15. Februar 1934, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Arthur Silbergleit: Moses Tod. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 7 vom 15. Februar 1934, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Arthur Silbergleit: Moses Tod. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 27 vom 28. Juli 1934, S. 4.
Arthur Silbergleit: Moses Tod. In: Kulturbund Deutscher Juden Monatsblätter, Berlin, 2. Jg., Nr. 12 vom Dezember 1934, S. 6.
Arthur Silbergleit: Moses Tod. 1935, 1 S.
Arthur Silbergleit: Vor der Tür des Jüdischen Wohlfahrtsamt. 1935, 1 S.
Gerson Stern: Fahrten in den Tag.
Gerson Stern: Weg ohne Ende. Ein jüdischer Roman. 1. Aufl., Berlin: Erich-Reiss-Verlag 1934, 475 S.
Weltmann, Dr. Lutz: Jüdische Dichter lesen. In: Jüdische Allgemeine Zeitung Jg. 15. Neue Folge der jüdische-liberalen Zeitung, Jg. 15, Nr. 43 (23.10.1935), S. 7, hier: S. 7.
Ohne Autor: Reichsverband der Jüdischen Kulturbünde in Deutschland. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 40, Nr. 83 (15.10.1935) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 10, hier: S. 10.
hs: Dichter im Kulturbund. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Jg. 25, Nr. 43 (27.10.1935), S. 7, hier: S. 7.
Arno Nadel: Musik.
Manfred Sturmann: Saul. 1935.
Manfred Sturmann: Saul. 1935.
Manfred Sturmann: Saul. 1936.
Ohne Autor: Aus unveröffentlichten Werken. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Jg. 25, Nr. 21 (26.05.1935), hier: S. 5.
George A. Goldschlag: Gebet. 1935.
George A. Goldschlag: Gebet. 1935.
George A. Goldschlag: Gebet. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 4.
Arno Nadel: Musik.
Manfred Sturmann: Tränen des Volkes. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 15. Jg., Nr. 15 vom 09. April 1936, S. 5.
Franz Werfel: Zwiesprache an der Mauer.
Schlesinger, Hanna (Ruth Morold): Rezitation aus neuer jüdischer Dichtung. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 42, Nr. 60 (30.07.1937) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 14, hier: S. 14.
Karl Escher: Epilog.
Herbert Friedenthal: Ein Schiff unterwegs. Die Geschichte einer Überfahrt. Illustriert von Käthe Schuftan. Berlin: Joachim Goldstein, Jüdischer Buchverlag 1938, 87 S.
Anna Joachimsthal-Schwabe: Die Nacht. 1937.
Anna Joachimsthal-Schwabe: Litanei der Armen. 1937.
Kurt Mayer: Es gedenke.
Kurt Mayer: Regen im Gebirge.
Kurt Mayer: Vor der Ausfahrt.
Leo Merten: Die Stille tönt.
Leo Merten: Einkehr.
Leo Merten: Reife.
Arno Nadel: Das große Opfer.
Arno Nadel: Tänze und Beschwörungen des Weissagenden Dionysos. 2. Aufl., Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1925, 42 S.
Ohne Autor: „Ungehörte Stimmen“. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland. Berlin: Verlag Jüdische Rundschau 1938, S. 13.
Micha Josef Bin-Gorion (Micha Josef Berdyczewski): Erste Liebe.
Arthur Silbergleit: Ruth. In: C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum, Berlin, 13. Jg., Nr. 20 vom 17. Mai 1934, S. 18.
Arthur Silbergleit: Ruth. In: C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum, Berlin, 13. Jg., Nr. 20 vom 17. Mai 1934, S. 18.
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Arthur Silbergleit: Ruth. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 39. Jg., Nr. 19 vom 13. Mai 1937, S. 17.
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Hugo von Hofmannsthal: Terzinen über Vergänglichkeit. 1922.
Franz Werfe: An den Leser. 1911, 2 S.
kp.: Zeitgenössische jüdische Lyrik und Prosa. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Jg. 26, Nr. 20 (17.05.1936), S. 4, hier: S. 4.
L.W.: Zeitgenössische jüdische Lyrik und Prosa. In: Reichsbund jüdischer Frontsoldaten e.V. (Hg.): Der Schild, Jg. 15, Nr. 19 (08.05.1936), S. 9, hier: S. 9.
WERKE
Prosa
Arno Nadel: Abraham oder: Die Entdeckung Gottes. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 27–34.
Arno Nadel: Jona. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 87–103.
Arno Nadel: Drei Augen-Blicke. Der schöne Gottfried. Verlag Düwell & Franke 1932, 47 S.
Artikel, Aufsätze, Essays
Arno Nadel: Aus dem Cyklus „Sabbath“. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 14. Jg., Nr. 2 vom 01. Februar 1924, S. 12.
Arno Nadel: Aus dem Cyklus „Sabbath“. „Scholaum alechem“. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 14. Jg., Nr. 3 vom 07. März 1924, S. 22.
Arno Nadel: Chad Gadjo. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 14. Jg., Nr. 5 vom 17. April 1924, S. 64.
Arno Nadel: Erneuerung und Vertiefung des Judentums. Gedanken zu einem Essay Leo Baecks „Geheimnis und Gebot“. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, Nr. 20 vom 18. Mai 1933, S. 12.
Leo Baeck: Geheimnis und Gebot. 1933.
Arno Nadel: Die Liturgie des Roschhaschono. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 33/34 vom 08. September 1934, S. 7–8.
Arno Nadel: Die Schabuoth-Melodie. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 23 vom 09. Juni 1935, S. 2.
Arno Nadel: Alte Musik an den hohen Feiertagen. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 39 vom 29. September 1935, S. 4.
Arno Nadel: Altes Lecho dodi für das Laubhütten-Fest. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 41 vom 13. Oktober 1935, S. 2.
Arno Nadel: Erster Notendruck der Chanukka-Hymne. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 51 vom 22. Dezember 1935, S. 21.
Arno Nadel: Die synagogale Musik. In: Friedrich Thieberger (Hg.): Jüdisches Fest, jüdischer Brauch. Ein Sammelwerk. Berlin: Jüdischer Verlag, 482 S., S. 46–50.
Arno Nadel: Rothstein-Wienawer-Hartenberg. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 1 vom 05. Januar 1936, S. 16.
Arno Nadel: Mit dreizehn Jahren. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 31 vom 30. Juli 1936.
Arno Nadel: Kol Nidre-Weise der marokkanischen Juden. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 39 vom 27. September 1936, S. 5.
Arno Nadel: „Odecha Ki Anitani“. Hallel-Weise des Salomone de Rossi (1570-1628). In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 40 vom 30. September 1936, S. 6.
Arno Nadel: Neue Freitagabend-Liturgie. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 44 vom 01. November 1936, S. 5.
A. N. [d. i. Arno Nadel]: „Addir Hu“. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 15 vom 04. Dezember 1936, S. 16.
Arno Nadel: Chasan und Bass in einem Hodu für Chanukka im Hannov. Kompendium 1744. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 49 vom 06. Dezember 1936, S. 6.
Arno Nadel: Pintschick's „Ribbono schel olom“ für die Sefira. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 19 vom 09. Mai 1937, S. 5.
Arno Nadel: Und eine Mahnung. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 39. Jg., Nr. 23 vom 10. Juni 1937, S. 9.
Arno Nadel: So sang der Kantor „Jaaleh“ am Kol-Nidre-Abend vor 100 Jahren. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 27. Jg., Nr. 37 vom 12. September 1937, S. 3.
Arno Nadel: Arno Nadel: Beschreibung des Hannoverschen Kompendiums. In: Musica Hebraica, Jerusalem, 1. Jg., Nr. 1 1938.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 252.
Arno Nadel: Um das jüdische Oratorium. Im Zusammenhang mit „Akedah“ von Hugo Adler, Mannheim. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 40. Jg., Nr. 18 vom 05. Mai 1938, S. 17.
Arno Nadel: Oberkantor Hoffmann verläßt Berlin. In: Jüdisches Nachrichtenblatt, Berlin, 2. Jg., Nr. 58 vom 21. Juli 1939, S. 7.
Rezensionen
Arno Nadel: Jüdische Klänge. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 35. Jg., Nr. 15 vom 13. April 1933, S. 15–16.
Jüdische Klänge / ausgew. von Leon Kornitzer. Schriftenreihe des Israelitischen Familienblattes ; 1. 1933.
Arno Nadel: Aron Friedmann: Das Gebet. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 27/28 vom 05. April 1934, S. 13.
Aron Friedmann: Das Gebet (Geißel), für eine Singstimme mit Orgel- oder Klavierbegleitung. Berlin. 1934.
80539 München
Arno Nadel: Ein James-Rothstein-Konzert im Bechsteinsaal. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 23 vom 07. Juni 1934, S. 10.
Arno Nadel: Kabarett-Abend der „Jüdischen Künstlerhilfe“. Dreißig Künstler bieten ihre beste Leistung. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 23 vom 07. Juni 1934, S. 10.
Arno Nadel: Ein neues Gottesdienst-Oratorium wurde aufgeführt. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 25 vom 14. Juli 1934, S. 5–6.
Arno Nadel: Ein neuer Sabbath-Psalm. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 66 vom 17. August 1934, S. 9.
Dr. Oskar Guttmann: Neue Komposition des 92. Psalms für gemischten Chor und Kantorsolo. In: Der jüdische Kantor. Zweimonatsschrift des allgemeinen deutschen Kantoren-Verbandes, Hamburg, 6. Jg., Nr. 1 1934.
20146 Hamburg
Arno Nadel: 3. Kleinkunstabend des Kulturbundes. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 44 vom 24. November 1934, S. 4–5.
Arno Nadel: Marion Koegel: Chansons und Lieder aller Länder. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 12 vom 24. März 1935, S. 11.
Arno Nadel: Sabbatmorgen-Liturgie komponiert von Jakob Dymont. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 2 vom 12. Januar 1936, S. 17.
Arno Nadel: Marion Koegel im Kulturbund. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 4 vom 26. Januar 1936, S. 7.
Arno Nadel: Sabbath Malk'So. Fünfzig ausgewählte Rezitative für den Freitag-Abend von Boas Bischofswerder, London. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 18 vom 03. Mai 1936, S. 22.
Arno Nadel: Hebräische Kunstmusik. Zur Aufführung von Jakob Weinbergs „Kabbolas Schaabas“ in der Synagoge Oranienburger Straße durch Chemja Winaver. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 42 vom 18. Oktober 1936, S. 16.
Arno Nadel: Die Geschichte vom Soldaten. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 46 vom 15. November 1936, S. 6.
Arno Nadel: Konzert in der Synagoge Lützowstraße. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 6 vom 07. Februar 1937, S. 6.
Arno Nadel: Tanzabend: Elsa Caro. (Juana Manorska). In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 13 vom 28. März 1937, S. 10.
Arno Nadel: Gollanins Liederabend. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 19 vom 09. Mai 1937, S. 7.
Arno Nadel: Oskar Guttmann: „Bereschit“. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1937, S. 4.
Arno Nadel: Singen am Schabbath. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 42. Jg., Nr. 53 vom 06. Juli 1937, S. 7.
Johannes Jacobsohn (Hanns John Jacobsohn): Sabbathklang und Festesang. Ein musikalischer Wegweiser für die häusliche Sabbath- und Festefeier. Leipzig: Philo GmbH – Jüdischer Buchverlag und Buchvertrieb 1937, 56 S.
20146 Hamburg
Porträts und Nachrufe
Arno Nadel: Der Komponist James Rothstein. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 16 vom 12. Mai 1934, S. 10.
Arno Nadel: Max Widetzky. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 34 vom 23. August 1936, S. 23.
Arno Nadel: An der Bahre eines Malers. Gedenkworte für Leo Prochownik. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 46 vom 12. November 1936.
Arno Nadel: Zum Gedächtnis von Josua Safirstein. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 17 vom 25. April 1937, S. 12.
Arno Nadel: Joseph Budko – 50 Jahre. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 40. Jg., Nr. 34 vom 25. August 1938, S. 20.
Weitere Sachtexte
Arno Nadel: Das gotische ABC. Verlag Fritz Gurlitt 1923.
Lyrik
Arno Nadel: Der Gast. In: Arno Nadel. Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S., S. 8.
Arno Nadel: Kein Zurück. In: Arno Nadel. Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S., S. 132.
Arno Nadel: Mitgefühl. In: Arno Nadel. Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S., S. 108.
Arno Nadel: Nach manchem Tag. In: Arno Nadel. Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S., S. 106.
Arno Nadel: Regentag. In: Arno Nadel. Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S., S. 3.
Arno Nadel: Um dieses alles. München, Leipzig: Georg-Müller-Verlag 1914, 167 S.
Arno Nadel: Rahels Tod. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 35–52.
Arno Nadel: „Rot und glühend ist das Auge des Juden“. Gedichte zu 8 Radierungen von Jacob Steinhardt. Illustriert von Jakob Steinhardt (Yaʿaḳov Shṭainharṭ). Verlag Fritz Gurlitt 1920, 26 S.
Arno Nadel: Die Erlösten. 10 Totenmasken. Franz Schneider Verlag 1924.
Arno Nadel: Heiliges Proletariat. 5 Bücher der Freiheit und Liebe. 1924.
Arno Nadel: Tänze und Beschwörungen des Weissagenden Dionysos. 2. Aufl., Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1925, 42 S.
Arno Nadel: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Lambert Schneider Verlag Heidelberg 1959, 691 S.
Arno Nadel: Der Ton. Die Lehre von Gott und Leben. Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 734 S.
Arno Nadel: Pessach. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 13 vom 29. März 1934, S. 18.
Arno Nadel: Des unsichtbaren Gottes Offenbarung an Israel. (Exodus, Kap. 19 und 20). In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 17 vom 19. Mai 1934, S. 3.
Arno Nadel: Das Leben des Dichters. Berlin. 1935, 160 S.
Arno Nadel: Tischah B'Ab. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 37. Jg., Nr. 32 vom 08. August 1935. Beilage „Jüdische Bibliothek. Unterhaltung und Wissen“.
Arno Nadel: Und Gott sprach – und es ward! In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 15. Jg., Nr. 15 vom 09. April 1936, S. 5.
Arno Nadel: „Hammelech“. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 38 vom 16. September 1936, S. 6.
Arno Nadel: Kol Nidre-Weise der marokkanischen Juden. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 39 vom 27. September 1936, S. 5.
Arno Nadel: „Odecha Ki Anitani“. Hallel-Weise des Salomone de Rossi (1570-1628). In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 40 vom 30. September 1936, S. 6.
Arno Nadel (Hg.): Zemirōt sǎbat. Die häuslichen Sabbatgesänge. Schocken-Verlag 1937, 88 S.
Arno Nadel: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Lambert Schneider Verlag Heidelberg 1959, 691 S.
Arno Nadel: Tänze und Beschwörungen des Weissagenden Dionysos. 2. Aufl., Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1925, 42 S.
Arno Nadel: Das große Opfer.
Ohne Autor: „Ungehörte Stimmen“. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland. Berlin: Verlag Jüdische Rundschau 1938, S. 13.
Arno Nadel: Kompendium Hallelujah! Gesänge für den jüdischen Gottesdienst.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Szenische Texte
Arno Nadel: Cagliostro. Drama in 5 Akten. Neuer Deutscher Verlag 1914.
Arno Nadel: Adam. Drama in 1 Vorspiel und 4 Akten. Insel Verlag Anton Kippenberg 1917.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 103 S.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. Eine biblische Szene. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 37. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Arno Nadel: Cagliostro und die Halsbandgeschichte. Schauspiel in 5 Akten. 2. Aufl., Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S.
Arno Nadel: Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Felix Stössinger Verlag und Antiquariat 1926, 103 S.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. Eine biblische Szene. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 37. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Arno Nadel: Moses Berufung. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 10 vom 31. März 1934, S. 2–3.
Arno Nadel: Ruth. Eine biblische Szene. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 37. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. In: Arno Nadel. Der Sündenfall. 7 biblische Szenen. Berlin: Jüdischer Verlag 1920, 103 S., S. 73–86.
Arno Nadel: Ruth. Eine biblische Szene. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 37. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Übersetzungen
S. Anski [d. i. Salomon An-ski]: Der Dybuk. Herausgegeben von Jüdisches Künstlertheater. Übersetzt von Arno Nadel. Berlin: Verlag Ost und West, Leo Winz 1921, 101 S.
Salomon An-ski: Zwischen zwaj Welten – der Dibuk. 1920.
Samuel Lewin: Chassidische Legende. Übersetzt von Arno Nadel. Illustriert von Joseph Budko. Berlin-Charlottenburg. 1924.
Samuel Lewin: Kegn Himl. 1921.
Abraham Moritz Silbermann (Hg.): Die Haggadah des Kindes. Übersetzt von Emil Moses Cohn. Berlin: Hebräischer Verlag Menorah 1933, 45 S.
Emil Bernhard-Cohn: Die Haggadah des Kindes. In: Blätter des Jüdischen Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung, Berlin, 9. Jg., Nr. 4 vom April 1933, S. 1–2.
Musikalische Werke
Nadel, Arno: Jontefflieder. 1919.
Arno Nadel: Louis Lewandowski (Zu seinem 100. Geburtstag). Vom 08. April 1921.
Arno Nadel: Musik-Beilage zum Artikel „Seder-Melodien“. Vom 17. April 1924.
Arno Nadel: Musikbeilage für den Artikel „Melodien um Tischah b'aw“. Vom 01. August 1924.
Arno Nadel: Hauptmelodien der Hohen Feiertage. Vom 26. September 1924.
Arno Nadel: Das Halberstädter Duchenen. Priestersegen für das Wochenfest. Vom 06. Juni 1924.
Arno Nadel: Hauptmelodien der hohen Feiertage. „Bor'schu“ und „Hammelech“. Vom 05. September 1924.
Arno Nadel: Kulturbundaufführung „Jeremias“ von Stefan Zweig. Vom 07. Oktober 1934.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010.
Werke Bildender Kunst
Ausstellung „Berliner jüdische Künstler auf Reisen“ des Sekretariats für bildende im Klubheim des Jüdischen Fraunebundes, Marburger Str. 5. 1937.
Schlesinger, H. (Ruth Morold): Berliner jüdische Künstler auf Reisen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 42, Nr. 98 (10.12.1937) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 14.
Verschiedenes
Arno Nadel: Chassidischer Ssimchas Tora-Tanz. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 27. Jg., Nr. 39 vom 26. September 1937, S. 6.
Arno Nadel: Chanukkah-Hodu. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 27. Jg., Nr. 49 vom 05. Dezember 1937, S. 5.
Arno Nadel: Musik.
Segall, Fritz: Aus unveröffentlichten Werken. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Jg. 25, Nr. 21 (26.05.1935), S. 5, hier: S. 5.
REPRESSIONEN
Zwangsmitgliedschaften
Reichsschrifttumskammer (RSK) (bis 07.03.1935)
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 179.
Zensur
Arno Nadel wurde auf der sogenannten „Goebbels-Liste“ verzeichnet und hatte damit ab September 1935 ein Aufführungsverbot (ab 09.1935)
Geiger, Friedrich: Die „Goebbels-Liste“ vom 1. September 1935. Eine Quelle zur Komponistenverfolgung im NS-Staat. In: Archiv für Musikwissenschaft, Jg. 59, Nr. 2 (2002) Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S. 104–112, hier: S. 107.
Inhaftierungen
Inhaftierung im KZ Sachsenhausen (ca. 09.11.1938/10.11.1938 – 29.11.1938)
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 53.
Verhaftung (ca. 01.03.1943/12.03.1943 – 12.03.1943)
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, S. 132.
Zwangsarbeit
Zwangsarbeit in der Bibliothek des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) (02.1942 – 12.03.1943)
Zahn, Christine: „Wer den Maler Arno Nadel noch nicht kennt, weiß von dem Dichter und findet in ihm den Musiker wieder“. In: Juden in Kreuzberg. Fundstücke, Fragmente, Erinnerungen. Berlin: Ed. Hentrich 1991, S. 299–304.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 112 ff.
Weitere Repressionen
Erzwungener Umzug (ab ca. 01.05.1941/30.05.1941)
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, S. 251.
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 56.
UNTERSTÜTZUNG
Erfahrene Hilfe
Hugo Chaim Adler: Verschaffen einer Anstellung (01.01.1939 – 31.12.1941)
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
Drees, Stefan: Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker. Sources relating to the History of Emigré Musicians 1933–1950, I Kalifornien / California. Herausgegeben von Schwartz, Manuela/Weber, Horst. München: Saur 2003, S. 171, 184.
Ewald Vetter: Bereitstellen eines Verstecks (01.01.1943 – 12.03.1943)
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, S. 60.
Albert Einstein: Fürsprache (am 17.05.1939)
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 106 f.
Fanja Okun: Ausstellen eines Affidavits (01.01.1940 – 31.12.1941)
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Staatsangehörigkeit
Russland
EMIGRATION
Emigration
Drees, Stefan: Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker. Sources relating to the History of Emigré Musicians 1933–1950, I Kalifornien / California. Herausgegeben von Schwartz, Manuela/Weber, Horst. München: Saur 2003, S. 171, 184.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 106 f.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, S. 107.
DEPORTATION
36. Ost-Transport (12.03.1943)
Nadel, Arno: Der weissagende Dionysos. Gedichtwerk. Berlin, Heidelberg, Gerlingen und Darmstadt: Verlag Lambert Schneider 1959, S. 679.
NACHLASSMATERIALIEN
SEKUNDÄRLITERATUR
Burghardt, Barbara: Arno Nadel. In: Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Hg.): Biographische Skizzen.
Gottgetreu, Erich: „Welch ein elender Unsommer“. Aus den Aufzeichnungen des Dichters Arno Nadel. In: Bulletin des Leo Baeck-Instituts, Vol. 14 (1975). 1975, S. 98–113.
Gottzmann, Carola L./Hörner, Petra: Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 3. N – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2007, 1476 S., hier: S. 945-959.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 17. Meid – Phil. Berlin und Boston: De Gruyter 2009, hier: S. 250-257.
Kilcher, Andreas: Der Schrecken der Geschichte „sub specie aeternitatis“. Arno Nadels Deutung der historischen Katastrophe aus der Mitte ihrer Erfahrung. In: Schoor, Kerstin (Hg.): Zwischen Rassenhass und Identitätssuche. Deutsch-jüdische literarische Kultur im nationalsozialistischen Deutschland. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 329–366.
Kilcher, Andreas: Nadel, Arno. In: Kilcher, Andreas B. (Hg.): Metzler-Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur [2. Aufl.]. Jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Stuttgart: Metzler 2012, S. 384–386.
Lowenthal, E. G. (Hg.): Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. München und Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1965, 199 S.
Nadel, Arno: „Arno Nadel – Schire Simroh. Liturgische Gesänge“. Potsdam: Universitätsverlag 2021.
Nemtsov, Jascha: Arno Nadel. Sein Beitrag zur jüdischen Musikkultur. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2008, 62 S.
Nemtsov, Jascha: Deutsch-jüdische Identität und Überlebenskampf. Jüdische Komponisten im Berlin der NS-Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010, 354 S., hier: S. 37-125.
Schipperges, Thomas: Arno Nadel. In: Fetthauer, Sophie/Petersen, Peter/Zenck, Claudia Maurer (Hg.): Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit. 2005.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, 579 S.
Schütz, Chana/Simon, Hermann: „Sonderarbeiten im behördlichen Auftrag“ (1941–1945). Bekannte und unbekannte Quellen – Das Tagebuch des Künstlers Arno Nadel. In: Schoor, Kerstin (Hg.): Zwischen Rassenhass und Identitätssuche. Deutsch-jüdische literarische Kultur im nationalsozialistischen Deutschland. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 441–460.
Zahn, Christine: „Wer den Maler Arno Nadel noch nicht kennt, weiß von dem Dichter und findet in ihm den Musiker wieder“. In: Juden in Kreuzberg. Fundstücke, Fragmente, Erinnerungen. Berlin: Ed. Hentrich 1991, S. 299–304.
Biografische Texte
Erich Mendel: Arno Nadel. Zu seinem 60. Geburtstag am 3. Oktober 1938. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 40. Jg., Nr. 39 vom 29. September 1938, S. 19.
Ohne Autor: Atelierbesuch bei Arno Nadel. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 18 vom 05. Mai 1935, S. 13.
Hanna Schlesinger (Ruth Morold): Neue Pastelle von Arno Nadel. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 41. Jg., Nr. 56 vom 14. Juli 1936, S. 9.
Dr. Max Osborn: Berliner jüdische Künstler in ihrer Werkstatt. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 40 vom 27. Oktober 1934, S. 3–4.
F. L. [d. i. Robert Baum]: Arno Nadel 60 Jahre. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 28. Jg., Nr. 40 vom 02. Oktober 1938, S. 4.
Lutz Weltmann: Arno Nadel 60 Jahre. Der Dichter und Maler. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 43. Jg., Nr. 78 vom 30. September 1938, S. 3.
20146 Hamburg
Dr. Max Osborn: Arno Nadel. Zum 60. Geburtstag am 3. Oktober. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 17. Jg., Nr. 40 vom 06. Oktober 1938, S. 5.
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin