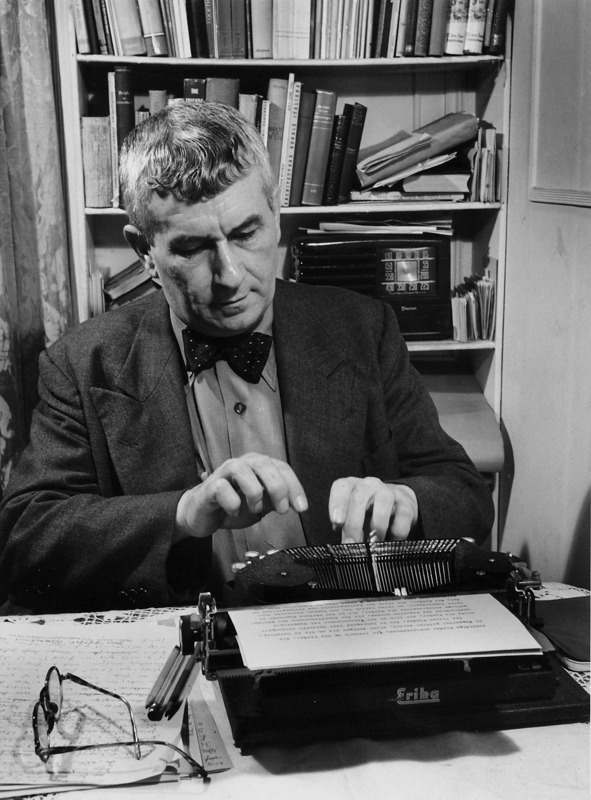Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 425.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht. In: Edschmid, Ulrike (Hg.): Diesseits des Schreibtischs. Lebensgeschichten von Frauen schreibender Männer. München: Luchterhand Verlag 1990, S. 149–187, hier: S. 167.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 254.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 261.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 258.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A./Institut für Zeitgeschichte/Research Foundation for Jewish Immigration, Inc. (Hg.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = International biographical dictionary of central European émigrés 1933–1945; Vol. II: The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 1281.
Pseudonyme und Kürzel
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10, 431.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 10.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A./Institut für Zeitgeschichte/Research Foundation for Jewish Immigration, Inc. (Hg.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = International biographical dictionary of central European émigrés 1933–1945; Vol. II: The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 1281.
GEBURT
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
TOD
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
RELIGION
katholisch (ab 24.09.1898)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 259.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 253.
FAMILIE
Ehe
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 255.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 268.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 277, 289.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 298.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
Kinder
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 297.
Eltern
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 251.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 251.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 254.
Geschwister
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
PERSÖNLICHES
Wohnorte
5 Via Giacomo Puccini, Milano – Milano (Mailand) (ab 09.1938)
2 Piazza Mentana, Firenze – Firenze (Florenz)
45 Avenue des Baumettes, Nice – Nice (Nizza)
Pension Stössinger – Berlin
Praha (Prag) (09.04.1890 – 1892)
Sankt Pölten (1892 – ca. 1892/1897)
Hainfeld (Niederösterreich) (ca. 1892/1897 – 1897)
Wien (1897 – ca. 15.07.1914/31.12.1914)
Pension Wasmer – Berlin (15.05.1935 – ca. 24.05.1935/31.05.1935)
Pension Wasmer – Berlin (ca. 01.04.1936/07.04.1936 – 10.07.1936)
München (ab ca. 05.1917/06.1917)
Schmelzbergstraße 34, Zürich (ab 10.1938)
Wilhelmshöher Straße 18/19, Berlin-Friedenau
Berlin-Wilmersdorf (ca. 15.07.1914/31.08.1914 – ca. 16.07.1914/31.08.1914)
Wien (ca. 16.07.1914/31.08.1914 – ca. 16.07.1914/30.12.1915)
Pension Nieszytka – Berlin (ca. 23.11.1930/14.12.1930 – ca. 14.12.1930/07.01.1931)
Pension Wasmer – Berlin (22.12.1935 – 08.01.1936)
Zähringerstraße 17, Berlin-Wilmersdorf (ab ca. 30.12.1915/18.03.1916)
Spichernstraße 3, Berlin-Wilmersdorf (ca. 16.07.1914/30.12.1915 – ca. 30.12.1915/18.03.1916)
Krankheiten
Rheuma
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 253.
SOZIALES MILIEU
Liselotte Zoff erinnerte sich rückblickend: "[Otto Zoff] war Halbjude. Seine Mut …
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht. In: Edschmid, Ulrike (Hg.): Diesseits des Schreibtischs. Lebensgeschichten von Frauen schreibender Männer. München: Luchterhand Verlag 1990, S. 149–187, hier: S. 167.
BILDUNGSWEG
Schule
Besuch der k.k. Staatsrealschule im 18. Wiener Bezirk (ab 1901)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 253.
Studium
Studium (1909 – 1914)
Röder, Werner/Strauss, Herbert A./Institut für Zeitgeschichte/Research Foundation for Jewish Immigration, Inc. (Hg.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = International biographical dictionary of central European émigrés 1933–1945; Vol. II: The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 1281.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 254 f.
MILITÄRISCHES
Kriegsteilnahme
Zweiter Weltkrieg
Keine Kriegsteilnahme
Erster Weltkrieg
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 256, 260 f.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
Ständige Mitarbeit (ab ca. 16.07.1914/30.12.1915)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 258.
Redaktionstätigkeit (ab ca. 09.1915/11.1915)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 261.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 258.
Lektoratstätigkeit (03.1917 – ca. 06.1917/08.1917)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 260 f.
Engagement bei den Münchner Kammerspielen (01.06.1917 – 06.1921)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 261 f.
Verlegerische Tätigkeit (1921 – 1922)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 263.
Engagement beim Lobetheater in Breslau (09.1928 – 31.01.1929)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 275, 277.
Lektoratstätigkeit (1933 – 01.01.1936)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 282, 285-287.
MITGLIEDSCHAFTEN
Röder, Werner/Strauss, Herbert A./Institut für Zeitgeschichte/Research Foundation for Jewish Immigration, Inc. (Hg.): Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 = International biographical dictionary of central European émigrés 1933–1945; Vol. II: The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 1281.
KONTAKTE
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 286.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 254.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 269.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht, S. 166.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 282, 284-286.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 265.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 258.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 281.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 264-266.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht, S. 170.
WERKE
Prosa
Otto Zoff: Roulette, streng wissenschaftlich. Prosa. In: Der Querschnitt, Berlin, 13. Jg., Nr. 13 1933, S. 529–531.
Artikel, Aufsätze, Essays
Otto Zoff/Theo Lingen: Die letzte Szene. Theaterglosse von Theo Lingen und Otto Zoff. 1933.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 122 f., 425.
Otto Zoff: Ein Kuss auf der Szene. In: Der Wiener Tag, Wien, 16. Jg., Nr. 3679 vom 16. August 1933, S. 6.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 425.
Rezensionen
Otto Zoff: „Die Schlafwandler“, Roman von Hermann Broch. In: Das Tagebuch, Berlin, 14. Jg., Nr. 14 1933, S. 272–274.
Hermann Broch: DIe Schlafwandler. Ca. 1931/1932.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 425.
Porträts und Nachrufe
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1939, 340 S.
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1939, 340 S.
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. 3. Aufl., Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1943, 340 S.
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. 3. Aufl., Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1943, 340 S.
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1939, 340 S.
Anita Silvestrelli [d. i. Otto Zoff]: Franz Schubert. Das wahre Gesicht seines Lebens. 3. Aufl., Salzburg, Leipzig: Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet 1943, 340 S.
Weitere Sachtexte
Otto Zoff: Die Hugenotten. Illustriert von E. K. Maenner. Leipzig, Wien: E. P. Tal & Co. 1937, 380 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Band II. Stand vom 31.12.1938. 1938, S. 168.
Szenische Texte
Otto Zoff: Rosen und Vergissmeinnicht. Komödie in 3 Akten. Berlin: Drei-Masken-Verlag 1933, 108 S.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 425.
Verschiedenes
Otto Zoff: Die Elevin. In: Neues Wiener Tagblatt, Wien, 68. Jg., Nr. 345 vom 16. Dezember 1934. Sonntags-Beilage.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 426.
REPRESSIONEN
Zwangsmitgliedschaften
Zensur
Verbot sämtlicher Schriften (ab 1941)
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Jahresliste 1941 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. 1941, S. 21.
Zensur des Werkes „Die Hugenotten“ (ab 31.12.1938)
Otto Zoff: Die Hugenotten. Illustriert von E. K. Maenner. Leipzig, Wien: E. P. Tal & Co. 1937, 380 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Band II. Stand vom 31.12.1938. 1938, S. 168.
Berufsverbote
Berufsverbot als Schriftsteller
Weitere Repressionen
Spielverbot für Otto Zoffs Stücke (ab ca. 03.1933/05.1933)
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 282.
UNTERSTÜTZUNG
Erfahrene Hilfe
Alfred Neumann: Fürsprache (ab 06.1938)
American Guild for German Cultural Freedom: Finanzielle Unterstützung (04.1939 – 06.1939)
American Guild for German Cultural Freedom: Finanzielle Unterstützung (ab 30.09.1940)
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Staatsangehörigkeit
USA (ab 25.05.1953)
Österreich
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
Tschechoslowakei
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1281.
EMIGRATION
Emigration ab ca. 24.05.1935/31.08.1935
Otto besaß „aus Zufall“ die tschechische Staatsangehörigkeit, beide Zoffs hatten tschechische Pässe. Damit gelang ihnen die Einreise nach Frankreich über den Grenzübergang Ventimiglia. Es gelang ihnen ebenfalls, Geld nach Frankreich zu schmuggeln, von dem sie in Frankreich vorerst ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Ihr Gepäck blieb wegen des Zolls an der italienisch-französischen Grenze hängen und wurde später von den Nazis konfisziert. Die drei Zoffs (Otto, Liselotte und die kurz zuvor geborene „Stanzi“) gingen nach Nizza, wo Liselotte trotz fehlender Arbeitserlaubnis als Gymnastiklehrerin bzw. Bewegungstherapeutin wieder etwas Geld verdienen konnte.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: K. G. Saur 1988, S. 286.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht, S. 169.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht, S. 180.
Zoff, Liselotte: Eine kleine Öffnung zum Licht, S. 166.
NACHLASSMATERIALIEN
Nachlässe in anderen Archiven
SEKUNDÄRLITERATUR
Edschmid, Ulrike: Diesseits des Schreibtischs. Lebensgeschichten von Frauen schreibender Männer. Darmstadt / Heidelberg: Luchterhand Literaturverlag 1990, 271 S.
Ohne Autor: In der Fremde für die Heimat. Sudetendeutsches Exil in Ost und West. München: Fides-Verlagsgesellschaft, 184 S.
Keller, Ulrike: Otto Zoffs dramatische Werke. Vom Theater zum Hörspiel. München: Saur 1988, 490 S.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Band 2. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983.