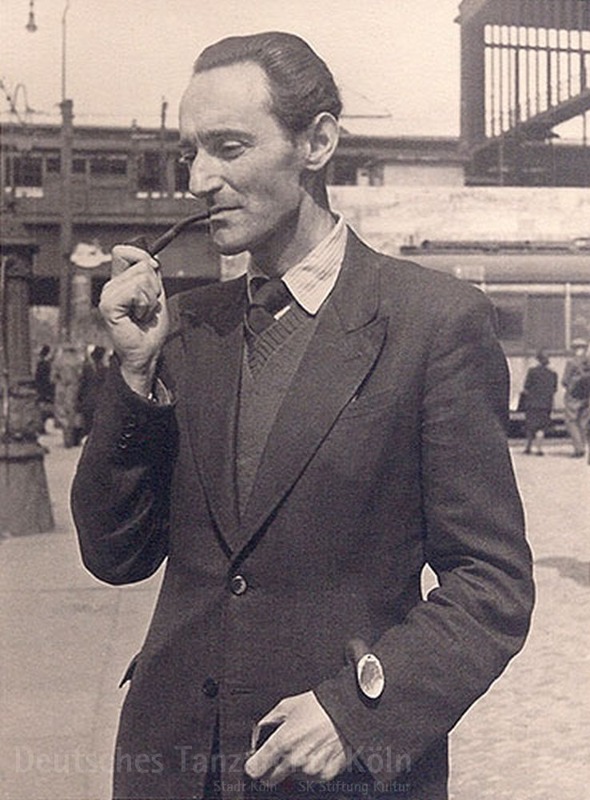Pseudonyme und Kürzel
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
Heuer, Renate: Bibliographia Judaica, Bd. 3. Verzeichnis jüdischer Autoren deutscher Sprache, S–Z. Frankfurt am Main: Campus Verlag 1988.
Habel, Walter: Wer ist wer? Das deutsche Who's who. Vormals Degeners Wer ist's? Seit 1905. Lübeck: Schmidt-Römhild 1955, S. 270.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
GEBURT
Habel, Walter: Wer ist wer? Das deutsche Who's who. Vormals Degeners Wer ist's? Seit 1905. Lübeck: Schmidt-Römhild 1955, S. 270.
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
TOD
Walk, Joseph: Kurzbiographien zur Geschichte der Juden 1918–1945. Herausgegeben von Leo Baeck Institute. München: K. G. Saur 1988.
Heuer, Renate: Bibliographia Judaica, Bd. 3. Verzeichnis jüdischer Autoren deutscher Sprache, S–Z. Frankfurt am Main: Campus Verlag 1988.
Killy, Walther/Vierhaus, Rudolf (Hg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 10. Thibaut – Zycha. München: Saur 1999.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Kühlmann, Wilhelm (Hg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, Bd. 12. Vo – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2011, S. 693.
FAMILIE
Ehe
Dörthe Zivier wurde, laut P. Fritsche, dreimal aufgefordert sich scheiden zu lassen, weigerte sich allerdings erfolgreich.
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 44 f.
Habel, Walter: Wer ist wer? Das deutsche Who's who. Vormals Degeners Wer ist's? Seit 1905. Lübeck: Schmidt-Römhild 1955, S. 270.
Kinder
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 44 f.
Es handelt sich hier um ein Skript einer Stadtführung, in der Georg Zivier und seine Frau erwähnt werden.
Eltern
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
PERSÖNLICHES
Wohnorte
Trabener Straße 25, Berlin-Grunewald
BILDUNGSWEG
Studium
Medizin, Philosophie, Naturwissenschaft
Habel, Walter: Wer ist wer? Das deutsche Who's who. Vormals Degeners Wer ist's? Seit 1905. Lübeck: Schmidt-Römhild 1955, S. 270.
Killy, Walther/Vierhaus, Rudolf (Hg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 10. Thibaut – Zycha. München: Saur 1999.
Kühlmann, Wilhelm (Hg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, Bd. 12. Vo – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2011, S. 693.
MILITÄRISCHES
Kriegsteilnahme
Erster Weltkrieg (bis 1918)
Lubos, Arno Joachim: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1961.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
Herausgeberschaft (ca. 1921/1922 – 31.12.1924)
Kühlmann, Wilhelm (Hg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, Bd. 12. Vo – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2011, S. 693.
Lubos, Arno Joachim: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1961.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Ausstellung des B'nai B'rith, Wien, 5. – 14. März 1967 im Künstlerhaus Wien. 1967.
Walk, Joseph: Kurzbiographien zur Geschichte der Juden 1918–1945. Herausgegeben von Leo Baeck Institute. München: K. G. Saur 1988.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Feuilleton-Redakteur (ab 1946)
Habel, Walter: Wer ist wer? Das deutsche Who's who. Vormals Degeners Wer ist's? Seit 1905. Lübeck: Schmidt-Römhild 1955, S. 270.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Kulturredakteur (1946 – 1955)
Lubos, Arno Joachim: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1961.
Freier Mitarbeiter
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Ausstellung des B'nai B'rith, Wien, 5. – 14. März 1967 im Künstlerhaus Wien. 1967.
Fester Mitarbeiter
Freier Mitarbeiter
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Beteiligt an Zeitungen
Der Feuerreiter. Blätter für Dichtung und Kritik (01.01.1922 – 31.12.1924)
KONTAKTE
Fischer, Erica: Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1998, S. 40.
Maltzan, Maria von: Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Erinnerungen. Berlin: Ullstein 1989, S. 125.
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 44 f.
Die Quelle ist unsicher. Allerdings zitiert er Georg Zivier zur Unterkunft von Else Lasker-Schüler. Die Herkunft des Zitats muss noch bestimmt werden, es wird keine Quellenangabe gemacht.
Schodrock, Karl: Georg Zivier. Biographisches. In: Schlesien (1968). Kunst, Wissenschaft, Volkskunde. Eine Vierteljahresschrift. Organ der Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien e.V, 13, 4 1968, S. 233, hier: S. 233.
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 45 f.
Fischer, Erica: Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1998, S. 111.
Die Quelle zitiert aus Originalquellen, Interviews mit Zeitzeug*innen etc., trägt allerdings nicht durchgängig dokumentarischen Charakter, sondern beinhaltet auch große Teile Fiktion und es wurde auch Kritik an der Autorin wie auch Elisabeth Wust von Zeitzeug*innen geäußert. Obgleich sich der Nachweis des Kontaktes zwischen den Ziviers und Schragenheim auf die nicht-fiktionalen Teile des Buches beziehen, muss dennoch darauf verwiesen werden.
Kühlmann, Wilhelm (Hg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, Bd. 12. Vo – Z. Berlin und Boston: De Gruyter 2011, S. 693.
VERANSTALTUNGEN
Schalom Ben-Chorin (Fritz Rosenthal): Wohin führt der Weg?
Gerda Senser: Saul, König in Israel.
Gerda Senser: Vorfrühling.
Georg Zivier: Vom Sohn des Himmels und seinem Volke.
Ohne Autor: Von Malern und Dichtern. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 19 (08.03.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 9, hier: S. 9.
Schalom Ben-Chorin (Fritz Rosenthal): Wohin führt der Weg?
Karl Escher: Der Schauspieldirektor.
Anna Joachimsthal-Schwabe: Litanei der Armen. 1937.
Vera Lachmann: Sils Maria.
Paul Mayer: Die Frau an den jungen Dichter.
Nelly Sachs: Nachtlied. In: Monatsblätter des Jüdischen Kulturbundes in Deutschland, Berlin, 7. Jg., Nr. 4 vom April 1939, S. 4.
Nelly Sachs: Schlaflied. In: Der Morgen. Monatsschrift der Juden in Deutschland, Berlin, 14. Jg., Nr. 2 vom Mai 1938, S. 64.
Martha Wertheimer: Jenseits der Flut.
Georg Zivier: Vom Sohn des Himmels und seinem Volke.
Ohne Autor: Ungehörte Stimmen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 74 (16.09.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 13, hier: S. 13.
Rogge-Gau, Sylvia: Die doppelte Wurzel des Daseins. Julius Bab und der Jüdische Kulturbund Berlin. Berlin: Metropol Verlag 1999, S. 134.
WERKE
Prosa
Georg Zivier/Hans Nowak: Zink wird Gold. Ein Roman des wirklichen Lebens. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn 1937.
Georg Zivier/Hans Nowak: Verdi, oder die Macht des Schicksals. Ein Lebensroman. Berlin: Ernst Keil Verlag Nachfolger (August Scherl) GmbH 1938.
Georg Zivier/Hans Nowak: Wenn es Tag wird. Roman. In: Die Woche. Moderne illustrierte Zeitschrift, Berlin 1940. Name der Beilage: „Wie sie lügen, wie sie hetzen“. Der (Fortsetzungs-)Roman erschien am 23.10.1940. Bislang wurde nur ein Teil identifiziert.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Breslauer Exodus. 1946.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Kurzgeschichten. 1946.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Kurzgeschichten. 1946.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Erzählungen, Fabeln und Satiren. Berlin: Chronos-Verlag 1949, 239 S.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Erzählungen, Fabeln und Satiren. Berlin: Chronos-Verlag 1949, 239 S.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Kurzgeschichten. 1946.
Georg Zivier: Licht und Schatten. Erzählungen, Fabeln und Satiren. Berlin: Chronos-Verlag 1949, 239 S.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Komödianten und fahrende Poeten. Erzählungen. Berlin: Lettner-Verlag 1956.
Georg Zivier: Nun komme ich als Richter. [Hörspiel]. 1965.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Ausstellung des B'nai B'rith, Wien, 5. – 14. März 1967 im Künstlerhaus Wien. 1967.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Georg Zivier: Vom Sohn des Himmels und seinem Volke.
Ohne Autor: Von Malern und Dichtern. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 19 (08.03.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 9, hier: S. 9.
Ohne Autor: Ungehörte Stimmen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 74 (16.09.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 13, hier: S. 13.
Sammelbände
Georg Zivier/Volker Ludwig/Hellmut Kotschenreuther: Kabarett mit K. 50 Jahre grosse Kleinkunst. Herausgegeben von Arnold Harttung. Illustriert von Rainer Hachfeld. Berlin: Berlin-Verlag 1974, 156 S.
Artikel, Aufsätze, Essays
Georg Zivier/Hans Nowak: Wenn es Tag wird. Roman. In: Die Woche. Moderne illustrierte Zeitschrift, Berlin 1940. Name der Beilage: „Wie sie lügen, wie sie hetzen“. Der (Fortsetzungs-)Roman erschien am 23.10.1940. Bislang wurde nur ein Teil identifiziert.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Der Aufstand der Frauen. In: Sie. Die Wochenzeitung für Frauenrecht und Menschenrecht, Berlin, 1. Jg., Nr. 2 vom Dezember 1945, S. 1.
Georg Zivier: Valeska. In: Die neue Zeitung. Eine amerikanische Zeitung für die deutsche Bevölkerung [Berliner Ausgab..., Berlin, 6. Jg., Nr. 293 vom 15. Dezember 1950.
Weitere Sachtexte
Georg Zivier: Harmonie und Ekstase. Mary Wigman. Herausgegeben von der Akademie der Künste. Herausgegeben von Akademie der Künste (Berlin, West). Berlin (West): Wasmuth Buchhandlung und Antiquariat 1956, 101 S.
Fritz Eschen: Junges altes Berlin. Bd. 1. Mit 64 Fotos aus dem neuen und alten Berlin. Mit einem Vorwort von Georg Zivier. 2. Aufl., Berlin: Stapp Verlag Wolfgang Stapp 1956, 79 S.
Fritz Eschen: Neues Altes Berlin. 1. Aufl., 1955.
Fritz Eschen: Junges altes Berlin. Bd. 1. Mit 64 Fotos aus dem neuen und alten Berlin. Mit einem Vorwort von Georg Zivier. 2. Aufl., Berlin: Stapp Verlag Wolfgang Stapp 1956, 79 S.
Georg Zivier: Schiller-Theater, Schlosspark-Theater, Berlin. Berlin: Stapp Verlag Wolfgang Stapp 1963, 83 S.
Georg Zivier: Ernst Deutsch und das deutsche Theater. Fünf Jahrzehnte deutscher Theatergeschichte. Der Lebensweg eines grossen Schauspielers. Berlin: Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung 1964, 188 S.
Georg Zivier: Das Romanische Café. Erscheinungen und Randerscheinungen rund um die Gedächtniskirche. 1. Aufl., Berlin: Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung 1965, 102 S.
Irmgard Wirth: Schaut auf diese Stadt. Vorwort von Georg Zivier. 1. Aufl., Berlin: Stapp Verlag Wolfgang Stapp 1965, 80 S.
Georg Zivier: Berlin und der Tanz. 1. Aufl., Berlin: Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung 1968, 96 S.
Georg Zivier: Vom Salon zum Audimax. Betrachtung über die gesellschaftlichen Strömungen in Berlin. In: Berliner Forum, Berlin, Nr. 9 1968.
Georg Zivier: Deutschland und seine Juden. Ein Buch gegen Vorurteile. Zeichnungen von Wilhelm M. Busch. Illustriert von Wilhelm M. Busch. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag 1971, 202 S.
Szenische Texte
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. 1. Aufl., 1933.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. 1. Aufl., 1933.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. Berlin, W 15, Schlüterstr. 41: Bühnenvertrieb Dr. Oscar Goetz 1946, 72 S.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. Berlin, W 15, Schlüterstr. 41: Bühnenvertrieb Dr. Oscar Goetz 1946, 72 S.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. 1. Aufl., 1933.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. Berlin, W 15, Schlüterstr. 41: Bühnenvertrieb Dr. Oscar Goetz 1946, 72 S.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Georg Zivier: Nun komme ich als Richter. [Hörspiel]. 1965.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Ausstellung des B'nai B'rith, Wien, 5. – 14. März 1967 im Künstlerhaus Wien. 1967.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Georg Zivier: Der Bär, der Hahn und der gelbe Stern. 1970.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Georg Zivier: Der Gouverneur. [Hörspiel].
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
Georg Zivier/Hans Nowak: Die kleinen Pechvögel und andere Hörfolgen.
Frenzel, Herbert A./Moser, Hans Joachim: Kürschners biographisches Theaterhandbuch. Schauspiel, Oper, Film, Rundfunk : Deutschland, Österreich, Schweiz. Berlin und Boston: De Gruyter 1956.
Georg Zivier: [Hörspiel über Heinrich Heine].
Lubos, Arno Joachim: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1961.
Georg Zivier: Theaterkongreß 1946. [Hörspiel].
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
Georg Zivier: Zwei junge Herren auf Reisen. [Hörspiel].
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
Musikalische Werke
Erwin Schulhoff: Xahoh-Tun. Dramatische Tanzgestaltung über ein antik-mexikanisches Original nach einer choreographischen Grundidee von Sent M'ahesa. 1923.
Vorträge
Georg Zivier: Theaterkongreß 1946. [Hörspiel].
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1952.
REPRESSIONEN
Zwangsmitgliedschaften
Reichsschrifttumskammer (RSK) (bis 19.11.1937)
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
Enthält u.a.: Rundschreiben des Sonderreferats Hinkel an die zum jüdischen Pressewesen gehörenden Personen und Unternehmen, 1937 „Judenliste der RSK“, 15. März 1937 Ausschaltung schädlicher Rückwirkungen der Rassenpolitik auf die auswärtigen Beziehungen des Reiches, Rundschreiben des Reichs- und Preußischen Mdl, 9. Februar 1935
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
Enthält u.a.: Rundschreiben des Sonderreferats Hinkel an die zum jüdischen Pressewesen gehörenden Personen und Unternehmen, 1937 „Judenliste der RSK“, 15. März 1937 Ausschaltung schädlicher Rückwirkungen der Rassenpolitik auf die auswärtigen Beziehungen des Reiches, Rundschreiben des Reichs- und Preußischen Mdl, 9. Februar 1935
Sonderrechte
Zwangsarbeit
Zwangsarbeit (nicht näher bestimmt) (ca. 19.11.1937/08.05.1945)
Es handelt sich hier um ein Skript einer Stadtführung, in der Georg Zivier und seine Frau erwähnt werden.
Walk, Joseph: Kurzbiographien zur Geschichte der Juden 1918–1945. Herausgegeben von Leo Baeck Institute. München: K. G. Saur 1988.
Lubos, Arno Joachim: Die schlesische Dichtung im 20. Jahrhundert. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 1961.
Schodrock, Christine: Georg Zivier 70 Jahre. In: Schlesien (1967). Kunst, Wissenschaft, Volkskunde. Eine Vierteljahresschrift. Organ der Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien e.V, 12, 1 1967, S. 63–64, hier: S. 63 f.
UNTERSTÜTZUNG
Geleistete Hilfe
Max Treitel (ca. 1941/1942)
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 44 f.
WIDERSTAND
Handlungen
Verstecken und Unterstützung Verfolgter
Fritsche, Petra T.: Die Villenkolonie Grunewald und ihre Bewohner. Historische und architektonische Betrachtungen 1889–1945. Berlin: Studentenwerk 2004, S. 45 f.
NACHLASSMATERIALIEN
Nachlässe in anderen Archiven
SEKUNDÄRLITERATUR
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982, 375 S.
Ohne Autor: Zivier, Georg. In: NDB-online.
Nachrufe
Ohne Autor: Zum Tod von Georg Zivier. In: Hamburger Abendblatt, Hamburg, 26. Jg., Nr. 69 vom 21. März 1974.
EHRUNGEN
Auszeichnungen
Brüder-Grimm-Preis 1963
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. 1. Aufl., 1933.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. 1. Aufl., 1933.
Georg Zivier: Perlicke-Perlacke. Ein Märchenspiel. Berlin, W 15, Schlüterstr. 41: Bühnenvertrieb Dr. Oscar Goetz 1946, 72 S.
Stern, Desider: Werke von Autoren jüdischer Herkunft in deutscher Sprache. Eine Bio-Bibliographie. Wien: Stern 1970, S. 177.
Schodrock, Christine: Georg Zivier 70 Jahre. In: Schlesien (1967). Kunst, Wissenschaft, Volkskunde. Eine Vierteljahresschrift. Organ der Freunde und Förderer der Stiftung Kulturwerk Schlesien e.V, 12, 1 1967, S. 63–64, hier: S. 63 f.
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1973.
Bundesverdienstkreuz 1968
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Bd. 2. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 1284.
Bundesverdienstkreuz
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Tetzlaff, Walter: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des 20. Jahrhunderts. Lindhorst: Askania 1982.
Ohne Autor: Kürschners Deutscher Literaturkalender. Berlin und Boston: De Gruyter 1973.