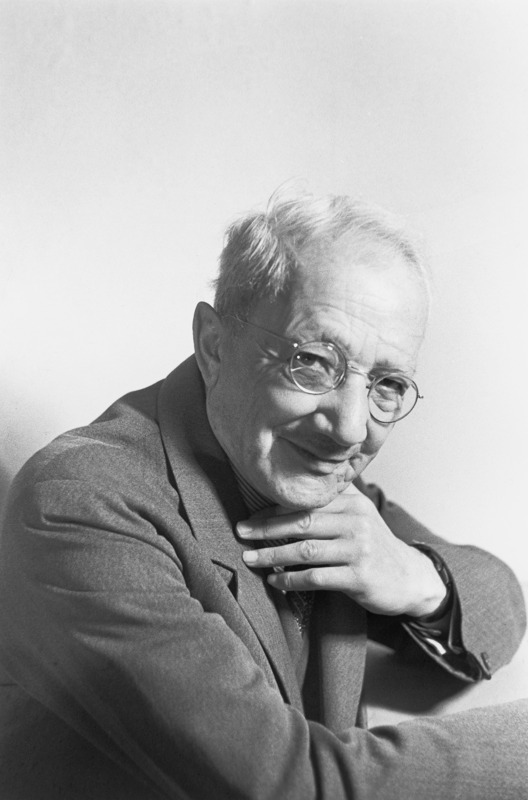60325 Frankfurt am Main
Pseudonyme und Kürzel
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 37.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. 2015, S. 7.
Heuer, Renate: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 21. Nachträge – Register. München: K. G. Saur 2013, S. XXVI.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
GEBURT
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
TOD
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
FAMILIE
Ehe
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 877.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
Kinder
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 877.
Eltern
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 876.
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1980, S. 876.
Geschwister
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 876.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 4.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 4.
Weitere Verwandtschaftsverhältnisse
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 10.
PERSÖNLICHES
Reisen
Reise nach Frankreich 1934 (1934)
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 163.
Reise in das Mandatsgebiet Palästina (1934 – 1935)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 12.
Reise in die USA mit seiner Tochter Renata (1935 – 1936)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 12.
Hobbys
Bergsteigen, Fahrradfahren
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 105.
BILDUNGSWEG
Schule
Gymnasium (1870 – 1881)
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 7.
Studium
Promotion im Fach Medizin (bis 07.03.1885)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 7.
Medizinisches Staatsexamen (bis 27.05.1886)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 7-8.
Promotion im Fach Ökonomie (bis 10.02.1908)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 7-8.
Medizinstudium
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 7.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
Hausarzt und Arzt für Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen (1886 – 1896)
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 9.
Chefredakteur der „Welt am Montag“ (1897 – 1898)
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 37.
Organisator eines Programmteils des 6. Zionistischen Kongresses 1903 (1903)
Bein, Alex: Franz Oppenheimer als Mensch und Zionist. In: Leo Baeck Institute Bulletin. 1964, S. 1–20, hier: S. 7.
Mitherausgeberschaft der Zeitschrift „Altneuland“ (1904 – 1906)
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 9.
Simeon, Ute: Compacy Memory. 20 Jahre Historische Jüdische Presse Online, ein Zwischenstand. In: Marten-Finnis, Susanne/Nagel, Michael (Hg.): Die historische deutsch-jüdische Presse. Forum, Sprachrohr und Quellenfundus. Bremen: Edition Lumière 2022, S. 365–382, hier: S. 380.
Tätigkeit als Privatdozent (ab 1909)
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 38–39.
Gründung einer Siedlungsgenossenschaft bei Merhavyah (ab 1911)
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 21.
Mitherausgeberschaft der „Neuen jüdischen Monatshefte“ (1916 – 1920)
Oppenheimer, Franz: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Oppenheimer, L. Y.. Düsseldorf: Jospeh Melzer-Verlag 1964, S. 223.
Professur (1919 – 1929)
Dozent an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums (1936 – 1938)
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 160-161.
Gründung von Siedlungsgenossenschaften in Deutschland
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 18–19.
Mitarbeiter
Ludwig Yehuda Oppenheimer (ab 1934)
Willms, Claudia: Franz Oppenheimer (1864–1943). Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2018, S. 241-242.
MITGLIEDSCHAFTEN
Deutsche Gesellschaft für Soziologie (1909 – 1934)
Komitee für den Osten (ab 1914)
Oppenheimer, Franz: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Oppenheimer, L. Y.. Düsseldorf: Jospeh Melzer-Verlag 1964, S. 223.
Willms, Claudia: Franz Oppenheimer (1864–1943). Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2018, S. 16-17.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 38.
KONTAKTE
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 157.
Holzer-Kawałko, Anna: Jewish Intellectuals between Robbery and Restitution. Ernst Grumach in Berlin, 1941–1946. In: Leo Baeck Institute Year Book. 2018, S. 273–295, hier: S. 278.
Rogge-Gau, Sylvia: Die doppelte Wurzel des Daseins. Julius Bab und der Jüdische Kulturbund Berlin. Berlin: Metropol Verlag 1999, S. 64 f.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 11.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 12.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 11.
Bein, Alex: Franz Oppenheimer als Mensch und Zionist. In: Leo Baeck Institute Bulletin. 1964, S. 1–20, hier: S. 7.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 12.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 10-11.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 10.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 10.
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 7.
Oppenheimer, Franz: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929, S. 37.
VERANSTALTUNGEN
Weltmann, Dr. Lutz: Professor Franz Oppenheimer über Palästina. In: Israelitisches Familienblatt, Jg. 39, Nr. 47 (25.11.1937), S. 23, hier: S. 23.
WERKE
Artikel, Aufsätze, Essays
Franz Oppenheimer: Staat und Nationalismus. In: Der Morgen. Zweimonatsschrift, Berlin, 8. Jg., Nr. 6 vom Februar 1933, S. 438–444.
60325 Frankfurt am Main
Franz Oppenheimer: Deutsch-jüdische Bauernsiedlung. Eine Erwiderung. In: Der Morgen, Berlin, 9. Jg., Nr. 1 vom April 1933, S. 49–53.
60325 Frankfurt am Main
Prof. Dr. Franz Oppenheimer: Juden als Siedler. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 3 vom 09. Februar 1934, S. 4–5.
Autobiographisches
Franz Oppenheimer: Mein wissenschaftlicher Weg. Leipzig: Felix Meiner Verlag 1929.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. 1. Aufl., Berlin: Welt-Verlag 1931.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. 1. Aufl., Berlin: Welt-Verlag 1931.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Ludwig Yehuda Oppenheimer. 2. Aufl., Düsseldorf: Joseph-Melzer Verlag 1964.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Ludwig Yehuda Oppenheimer. 2. Aufl., Düsseldorf: Joseph-Melzer Verlag 1964.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. 1. Aufl., Berlin: Welt-Verlag 1931.
Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenserinnerungen. Herausgegeben von Ludwig Yehuda Oppenheimer. 2. Aufl., Düsseldorf: Joseph-Melzer Verlag 1964.
Weitere Sachtexte
Franz Oppenheimer: Weder so – noch so. Der dritte Weg. Potsdam: Alfred Protte Verlag 1933, 107 S.
Dahm, Volker: Das jüdische Buch im Dritten Reich. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) 1993, S. 175.
Dahm, Volker: Das jüdische Buch im Dritten Reich. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) 1993, S. 175.
Franz Oppenheimer: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Ein kurzgefaßtes Lehrbuch der nationalökonomischen Theorie. 1. Aufl., Leiden: Sijthoff 1938, 493 S.
Lyrik
Rudyard Kipling: Akbar's Brücke. Nach dem Englischen des Rudyard Kipling. Deutsch von Franz Oppenheimer. Übersetzt von Franz Oppenheimer. In: Kulturbund Deutscher Juden Monatsblätter, Berlin, 1. Jg., Nr. 2 vom November 1933, S. 7–8.
Franz Oppenheimer: Der Prophet. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 38. Jg., Nr. 99 vom 12. Dezember 1933, S. 945.
Franz Oppenheimer: Föhnstimmung. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 25/26 vom 28. März 1934, S. 17.
20146 Hamburg
Wissenschaftliche Arbeiten
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Franz Oppenheimer: Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus. 1. Aufl., Berlin; Leipzig: Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. 1919, 226 S.
Franz Oppenheimer: Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus. 1. Aufl., Berlin; Leipzig: Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. 1919, 226 S.
Franz Oppenheimer: Oppenheimer, Franz: Weder Kapitalismus noch Kommunismus. 2. Aufl., Jena. 1932, 230 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Franz Oppenheimer: Oppenheimer, Franz: Weder Kapitalismus noch Kommunismus. 2. Aufl., Jena. 1932, 230 S.
Franz Oppenheimer: Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus. 1. Aufl., Berlin; Leipzig: Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. 1919, 226 S.
Franz Oppenheimer: Oppenheimer, Franz: Weder Kapitalismus noch Kommunismus. 2. Aufl., Jena. 1932, 230 S.
Franz Oppenheimer: System der Soziologie. Band 4: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderg bis zur Gegenwart, Teil 1: Rom und die Germanen. 1. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1933, 412 S.
Franz Oppenheimer: System der Soziologie. Band 4: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderg bis zur Gegenwart, Teil 2: Adel und Bauernschaft. Das Mittelalter. 1. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1933.
Franz Oppenheimer: System der Soziologie. Band 4: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderg bis zur Gegenwart, Teil 3, Stadt und Bürgerschaft: Die Neuzeit. Jena: G. Fischer Verlag 1935.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Verschiedenes
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Erzählung. Bern, Leipzig: Gotthelf-Verlag 1934, 185 S.
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Erzählung. Bern, Leipzig: Gotthelf-Verlag 1934, 185 S.
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Herausgegeben von Claudia Willms. Berlin: Quintus 2017, 191 S.
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Herausgegeben von Claudia Willms. Berlin: Quintus 2017, 191 S.
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Erzählung. Bern, Leipzig: Gotthelf-Verlag 1934, 185 S.
Francis D. Pelton [d. i. Franz Oppenheimer]: Sprung über ein Jahrhundert. Herausgegeben von Claudia Willms. Berlin: Quintus 2017, 191 S.
REPRESSIONEN
Zensur
Aufnahme in die Liste des „schädlichen und unerwünschten Schrifttums“
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Zensiertes Werk „Weder so – noch so - Der dritte Weg“ (ab 08.1935)
Franz Oppenheimer: Weder so – noch so. Der dritte Weg. Potsdam: Alfred Protte Verlag 1933, 107 S.
Dahm, Volker: Das jüdische Buch im Dritten Reich. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) 1993, S. 175.
Bücherverbrennung (03.1933 – 10.1933)
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Zensiertes Werk „Der Staat“ (ab 25.04.1935)
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1912, 176 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. Frankfurt am Main: Literarische Anstalt Rütten und Loening 1919, 179 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 3. Aufl., Jena: G. Fischer Verlag 1929, 138 S.
Franz Oppenheimer: Der Staat. 4. Aufl., Stuttgart: G. Fischer Verlag 1954, 138 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 90.
Berufsverbote
Berufsverbot als Schriftsteller
Berufsverbot als Dozent
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 152–154.
Weitere Repressionen
Entzug des Reisepasses (1938)
Caspari, Volker/Lichtblau, Klaus: Franz Oppenheimer. Ökonom und Soziologe der ersten Stunde. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag 2014, S. 163.
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Staatsangehörigkeit
Deutschland
Röder, Werner/Strauss, Herbert A. (Hg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945, Volume II. The Arts, Sciences, and Literature. München: K. G. Saur 1983, S. 876.
EMIGRATION
Emigration ab 1938
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
Lichtblau, Klaus: Einleitung. In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Franz Oppenheimer. Schriften zur Soziologie. 2015, S. 7–24, hier: S. 12.
NACHLASSMATERIALIEN
Nachlässe in anderen Archiven
SEKUNDÄRLITERATUR
Willms, Claudia: Franz Oppenheimer (1864–1943). Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2018.
Biografische Texte
Ohne Autor: Deutsche Juden vor 50 Jahren. Zu Franz Oppenheimers 70. Geburtstag. In: Bayerische Israelitische Gemeindezeitung. Nachrichtenblatt der Israelitischen Kultusgemein..., München, 10. Jg., Nr. 6 vom 15. März 1934, S. 110–113.
Dr. Ernst Simon: Der Historiker Franz Oppenheimer. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 25/26 vom 28. März 1934, S. 17.
20146 Hamburg
Ohne Autor: Franz Oppenheimer, der Jude. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 25/26 vom 28. März 1934, S. 17.
20146 Hamburg
Gottfried Salomon: Franz Oppenheimer als Soziologe. [Franz Oppenheimer, der Siebziger]. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 25/26 vom 28. März 1934, S. 17.
20146 Hamburg
Dr. Olga Bloch: Professor Franz Oppenheimer. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 17. Jg., Nr. 37 vom 15. September 1938, S. 13.
Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin
Privatdozent Dr. Paul Eppstein: Franz Oppenheimer – siebzigjährig. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 10 vom 31. März 1934, S. 4–5.
Nachrufe
M. W. [d. i. Michael Wurmbrand]: Franz Oppenheimer. Eine zionistische Legende. In: Aufbau. An american Weekly published in New York = Reconstruction, New York City, 9. Jg., Nr. 42 vom 15. Oktober 1943, S. 5–6.
Privatdozent Dr. Paul Eppstein: Franz Oppenheimer – siebzigjährig. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 10 vom 31. März 1934, S. 4–5.