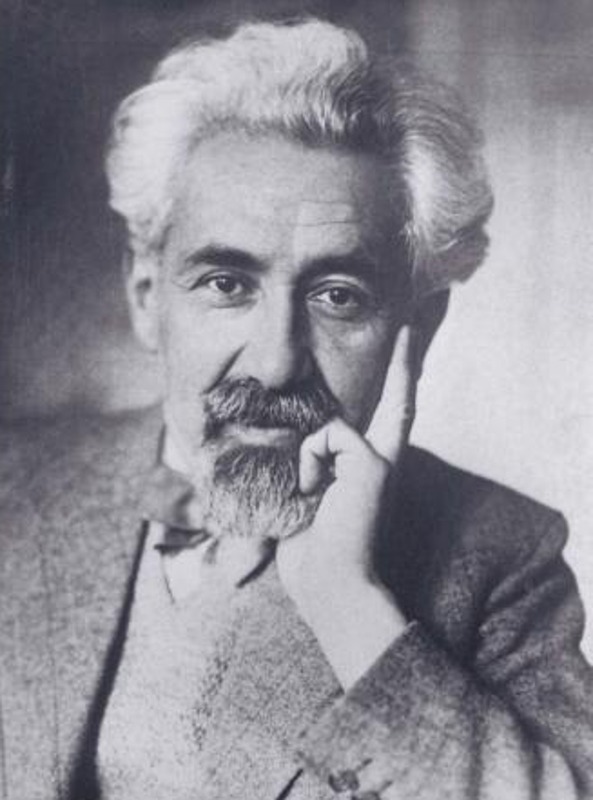Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 16.
Pseudonyme und Kürzel
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
GEBURT
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
TOD
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
RELIGION
jüdisch
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 35.
FAMILIE
Ehe
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Kinder
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Eltern
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Geschwister
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
PERSÖNLICHES
Wohnorte
Westfälische Straße 59, Berlin-Halensee
Häufig frequentierte Orte
Reisen
Reise nach Schweden, um Selma Lagerlöf zu besuchen (1934)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50.
Reise nach Israel (03.1935)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50.
Reise nach Israel (ca. 01.1938/04.1938)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 54.
Aufenthalt auf Kuba (ca. 02.1939/12.1939)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 55.
Ereignisse
„Cohn-Affäre“
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 23 ff.
SOZIALES MILIEU
"As assimilated and acculturated Jews within German society, Emil and his six si …
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 16.
BILDUNGSWEG
Schule
Gymnasium Steglitz (bis 1890)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Prinz Heinrich Gymnasium Berlin (1890 – 1899)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208.
Studium
Philologie mit Schwerpunkt Orientalische Wissenschaften in Berlin (ab 1899)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 208 f.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 20.
Rabbinische Studien in Berlin (1899 – 1905)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 21.
Promotion in Heidelberg (ca. 01.01.1902/11.03.1903 – 11.03.1903)
Emil Moses Cohn: Der Wucher (Ribâ) in Quor'ân, Chadîth und Fiqh. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des muhammedanischen Rechtes. Berlin. 1903.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Jura in Kiel (1907 – 1908)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 31.
Sprachkenntnisse
Englisch
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Hebräisch
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Französisch
Akademie der Künste (Hg.): Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933–1941. Berlin: Ed. Hentrich 1992, S. 292.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
Redaktionsmitglied bei „Der jüdische Student“ (1904 – 1905)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 210.
Religionslehrer (ab 1905)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Prediger (03.1906 – 15.04.1907)
Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Entlassung von Cohn: Eine Streitschrift geg. Vorstand u. Repräsentanz der Jüd. Gde zu Bin von Rabb. Dr. E' C'. (Nebst seiner Broschüre „Die Geschichte meiner Suspension“ als Anh.). Bin 1907 (Druck v. Rosenthal u. Co.), 16 u. 12 S., 23,8 χ 16,3 cm, Pappbd. - [Vorw.,] S. 3f.: „[...] Es ist mir nicht angenehm, die Öffentlichkeit immer wieder mit meiner Person zu behelligen, u' tief schmerzlich ist es für mich, vor den Augen der Welt Dinge zu erörtern, die die erste jüdische Behörde Deutschlands blosstellen. Aber ich muß. [...] Ich bin vergewaltigt u' muß mich wehren. [...] Berlin, den 10. Mai 1907. E' C'.“ - Inh.: Mein Kampf ums Recht: Meine Anstellung, S. 5; I. Mein Verhalten am Falkrealgymn., S. 6; II. Die Herzlgedenkrede, S. 9; III. Mein Gespräch mit dem Direktor des Mommsengymnasiums, S. 10. Anh.: Die Geschichte meiner Suspension. Eine kurze sachliche Information. - [Vorw.,] S. (3): „Dies ist die Geschichte meiner Suspension vom Amt des Predigers u' Religionslehrers der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Von denjenigen gezwungen, die mich verurteilt haben, übergebe ich sie der Öffentlichkeit. Berlin, den 20. April 1907. £' C'.“ - Inh.: I. Ursache u. Grund meiner Suspension, S. 4; II. Die vorläufige Suspension, S. 6; III. Die Mitteilung an den Gemeindevorstand, S. 8; IV. Die Gerüchte, S. 9; V. Weiterer Verlauf, S. 9. Außerdem Bericht der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde vom 05.05.1907 und „Drei Vorträge vom Vortragsabend des Liberalen Vereins am 10. Juni 1907“.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Rabbiner (1908 – 1912)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Rabbiner (1912 – 1914)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Rabbiner (1914 – 1926)
Laut Biographischem Handbuch der Rabbiner musste Cohn in Bonn die Erklärung abgeben, er „werde weder Kanzel noch Katheder zu zionistischer Propaganda benutzen und daher weder in Schule, Predigt, oder sonst in Ausübung meines Amtes zionistische Ideen lehren, verbreiten oder für den Zionismus werben oder sprechen.“
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Dozent für mittelalterliche Philosophie (1914 – 1925)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Dozent für Hebräisch (1914 – 1925)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Herausgeber des „Jüdischen Boten vom Rhein“ (1919 – 1923)
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 210.
Rabbiner (1925 – 10.1936)
Laut biographischem Handbuch der Rabbiner vertrat Cohn eine konservativ-zionistische Ausrichtung. Laut Lexikon deutsch-jüdischer Autoren ist Cohn erst ab 1927 Rabbiner an der Synagoge Grunewald.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Vorsitzender (1933)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
„work with German-Jewish refugee community“ in Amsterdam (1937 – 01.1939)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 54.
Stellvertretender Rabbiner (02.1939 – 1941)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Rabbiner (1941 – 1945)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Dozent für hebräische Literatur (1941 – 1945)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Rabbiner (1945 – 1946)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Rabbiner (1945)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Dozent für jüdische Geschichte (ab 1945)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Bibliothekar (1947 – 1948)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Beteiligt an Zeitungen
MITGLIEDSCHAFTEN
National-jüdischer Verein der Hörer an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums ... (1901 – 1902)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Misrachi (ab 1914)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Free Synagogue (02.1939 – 1941)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Beth Jacob (1941 – 1945)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
KONTAKTE
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 39.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 39.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 36.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 14.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 14.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 14.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 36.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 38.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 39.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 39.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 39.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 46.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 49 f.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 51 f.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 36.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 57.
VERANSTALTUNGEN
Ohne Autor: „Hiob – ein aktuelles Zeitproblem“. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 38, Nr. 11 (07.02.1933) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 53.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Ohne Autor: Jüdische Rundschau, Jg. 36, N° 95 (08.12.1931). Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland. Berlin: Verlag Jüdische Rundschau 1931, S. 361.
Schoor, Kerstin: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945. Göttingen: Wallstein Verlag 2010, S. 132.
Emil Bernhard: Der Brief des Uria. Ein Trauerspiel in fünf Akten. Bonn: Botenverlag 1919, 88 S.
Ohne Autor: Voranzeigen. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 41, Nr. 84 (20.10.1936) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 14, hier: S. 14.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50.
Ohne Autor: Die Cherubim in Kunst und Schrifttum. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Jg. 25, Nr. 46 (17.11.1935), S. 6, hier: S. 6.
Dr. O. B.: Dr. Rahel Wischnitzer Bernstein: Die Cherubim in der jüdischen Kunst. In: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V. (Hg.): C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Jg. 14, Nr. 50 (12.12.1935) Berlin: Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V, S. 6, hier: S. 6.
Richard Beer-Hofmann: Jaákobs Traum. Ein Vorspiel. Berlin: S. Fischer Verlag 1918, 170 S.
Emil Moses Cohn: Die fremden Jahre.
Max Dienemann: Sehnsucht nach Zion.
Eugen Tannenbaum: Die liebe Familie. Eine teils heitere, teils melancholische Betrachtung. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 35. Jg., Nr. 36 vom 07. September 1933, S. 13.
Ohne Autor: „Was uns trägt“. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 82/83 (14.10.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 18, hier: S. 18.
WERKE
Prosa
Emil Bernhard Cohn: Legenden. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 144 S.
Bertha Badt-Strauß: Emil Bernhard Cohn: Legenden. S. Scholem Verlag, Berlin-Schöneberg. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 39. Jg., Nr. 23 vom 20. März 1934, S. 5.
Leo Hirsch: Unsere schönsten Legenden. Emil Bernhard Cohn, Legenden. In: C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum, Berlin, 13. Jg., Nr. 9 vom 01. März 1934. 2. Beilage.
Emil Bernhard: Der Rabbi erzählt vom Bildnis Moses. In: Kulturbund Deutscher Juden Monatsblätter, Berlin, 1. Jg., Nr. 4 vom Dezember 1933, S. 6–7.
Emil Moses Cohn/Ester Rabin (Hg.): Jüdisches Jugendbuch. Fünfter Jahrgang des Jüdischen Jugendkalenders. Berlin: Jüdischer Verlag 1935.
-ss. [d. i. Bertha Badt]: Ein Jüdisches Jugendbuch. Neue Bücher zu Chanukka. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 48 vom 29. November 1936, S. 16.
G. H. [d. i. Auguste Hecht]/L. H. [d. i. Leo Hirsch]: Bücher für die Jugend. In: Jüdischer Kulturbund Berlin Monatsblätter, Berlin, 3. Jg., Nr. 12 vom Dezember 1935, S. 8–29. Fortsetzung der auf S. 8 begonnenen Sammelrezension auf S. 29.
H.K. [d. i. Hannah Karminski]: Ludwig Strauss. Die Zauberdrachenschnur; Jüdisches Jugendbuch; Emanuel bin Gorion. Das siebenfache Licht. In: Blätter des Jüdischen Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung, Berlin, 13. Jg., Nr. 1 vom Januar 1937, S. 13.
Ohne Autor: Jüdisches Jugendbuch. Herausgegeben von Emil Bernhard Cohn. Jüdischer Verlag Berlin. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 44 vom 29. Oktober 1936. Kinderbeilage „Unser Familienblatt“.
Ester Rabin: Gedruckter Herausgebername: Else Rabin
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 11 vom 17. März 1935, S. 4–5.
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 11 vom 17. März 1935, S. 4–5.
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Erwin Löwe (Hg.): Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen u. [Aus-]Malen. Illustriert von Ruth Agnes Veit Simon. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 48 S., S. 21–28.
Emil Cohn: Chanukka-Legende. Chanukka für Kinder. In: Mitteilungen der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin, Berlin, 25. Jg., Nr. 51 vom 22. Dezember 1935, S. 5.
Emil Bernhard Cohn: Die vergessene Broche. Chanukka für Kinder. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 51 vom 22. Dezember 1935, S. 6.
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Erwin Löwe (Hg.): Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen u. [Aus-]Malen. Illustriert von Ruth Agnes Veit Simon. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 48 S., S. 21–28.
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 11 vom 17. März 1935, S. 4–5.
Emil Bernhard Cohn: Der Stolz des Hoffärtigen. Ein Zusatz zum Buche Esther. In: Erwin Löwe (Hg.): Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen u. [Aus-]Malen. Illustriert von Ruth Agnes Veit Simon. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 48 S., S. 21–28.
Emil Bernhard Cohn: Die Legende von Rabbi Akiba. In: Friedrich Thieberger (Hg.): Jüdisches Fest, jüdischer Brauch. Ein Sammelwerk. Berlin: Jüdischer Verlag, 482 S., S. 266–269.
Friedrich Thieberger (Hg.): Jüdisches Fest, jüdischer Brauch. Ein Sammelwerk. Berlin: Jüdischer Verlag, 482 S.
Emil Moses Cohn (Hg.): Jüdisches Jugendbuch. Sechster Jahrgang des Jüdischen Jugendkalenders. Jüdischer Verlag 1936, 100 S.
Emil Moses Cohn: Man muß an die Zukunft denken. In: Erwin Löwe (Hg.): Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen u. [Aus-]Malen. Illustriert von Ruth Agnes Veit Simon. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 48 S., S. 8–12.
Emil Moses Cohn: Ölbaum, Kind u. Kapsel. Ein Legendchen für Chanukka. In: Erwin Löwe (Hg.): Die bunte Schüssel. Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen u. [Aus-]Malen. Illustriert von Ruth Agnes Veit Simon. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 48 S., S. 17–19.
Emil Bernhard Cohn: Serach, Tochter Aschers. Eine Legende von Emil Bernhard Cohn. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 15 vom 12. April 1936, S. 16.
Emil Bernhard Cohn: Und das Meer hörte zu brausen auf. Eine Legende. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 21 vom 24. Mai 1936, S. 7.
Emil Moses Cohn: Die fremden Jahre.
Ohne Autor: „Was uns trägt“. In: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Jg. 43, Nr. 82/83 (14.10.1938) Berlin: Verlag Jüdische Rundschau, S. 18, hier: S. 18.
Sammelbände
Emil Moses Cohn (Hg.): Jüdischer Kinderkalender. Berlin: Jüdischer Verlag 1928.
Bertha Badt-Strauss: Ein jüdischer Kinderkalender. 1. Jahrgang. Herausgegeben von Emil Bernhard Cohn. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 33. Jg., Nr. 84 vom 23. Oktober 1928, S. 589.
Emil Bernhard Cohn: Jüdischer Jugendkalender. Bd. 4. Herausgegeben von Emil Moses Cohn. Berlin: Jüdischer Verlag 1934.
Emil Bernhard/Vera I. Arlett: Four Jewish plays. Herausgegeben von Harold Frederick Rubinstein. Übersetzt von Berta Meyer (Berta Morena). London: Victor Gollancz Ltd. 1948, 303 S.
Artikel, Aufsätze, Essays
Emil Moses Cohn: Was wir sind, was wir haben. Betrachtungen zum Schowuausfest. In: Gemeindeblatt der Israelitischen Religionsgemeinde Dresden. Amtliches Organ des Gemeindevo..., Dresden, 10. Jg., Nr. 5 vom 15. Mai 1934.
Emil Bernhard Cohn: Zur Auseinandersetzung Joachim Prinz – Heinrich Stern. Ein ernstes Wort. In: Israelitisches Familienblatt, Hamburg, 36. Jg., Nr. 41 vom 11. Oktober 1934, S. 10.
Emil Bernhard Cohn: Chanukka. Das Fest der Kinder. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 45 vom 01. Dezember 1934, S. 8.
Emil Bernhard Cohn: Man muß an die Zukunft denken. Die Seite des Kindes. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 7 vom 17. Februar 1935, S. 24.
Emil Bernhard Cohn/Hans Bach: Das jüdische ABC. Eine Auseinandersetzung zwischen Herausgeber und Kritiker. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 14. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, S. 8.
Hans Bach: Das jüdische ABC. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 14. Jg., Nr. 22 vom 30. Mai 1935, S. 9, 2. Beiblatt.
Emil Bernhard Cohn: Das jüdische ABC. Ein Führer durch das jüdische Wissen. Herausgegeben von Emil Moses Cohn. 1. Aufl., illustriert von Joseph Avrach. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1935, 336 S.
Emil Moses Cohn: Ein alter Zionist fährt zum ersten Mal nach Palästina. In: Israelitisches Familienblatt (Hamburg), Hamburg vom 06. Juni 1935.
Emil Bernhard Cohn: Buch und Landschaft. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 31 vom 04. August 1935, S. 4.
Emil Bernhard Cohn: Simchat Tora für Kinder. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 42 vom 20. Oktober 1935, S. 4.
Emil Moses Cohn: The Zionist Spirit. In: The New Palestine, New York, 29. Jg., Nr. 36 vom 17. November 1939, S. 5.
Emil Moses Cohn: The Return to Judaism. The Growth of a Revived Religious Life in the Land of Israel. In: The New Palestine, New York, 29. Jg., Nr. 40 vom 15. Dezember 1939, S. 5.
Emil Moses Cohn: The Land vs. the People. In: The New Palestine, New York, 29. Jg., Nr. 41 vom 22. Dezember 1939, S. 5.
Emil Moses Cohn: A Lesson from Cervantes. A Modern View of Don Quixote Indicates the Role of the Spirit in World Affairs. In: The New Palestine, New York, 29. Jg., Nr. 42 vom 29. Dezember 1939, S. 5.
Emil Moses Cohn: The Haunting Sense of Insecurity. In: The New Palestine, New York, 30. Jg., Nr. 1 vom 05. Januar 1940, S. 2.
Emil Moses Cohn: The Sense of History. In: The New Palestine, New York, 30. Jg., Nr. 6 vom 09. Februar 1940, S. 5.
Emil Moses Cohn: Reminiscences of Selma Lagerloef. Famed Swedish Poet and Nobel Prize Winner Was Friend of Jewish People. In: The New Palestine, New York, 30. Jg., Nr. 12 vom 22. März 1940, S. 5.
Emil Moses Cohn: Subsisting upon Leavings. In: The New Palestine, New York, 30. Jg., Nr. 23 vom 24. Juni 1940, S. 5.
Emil Moses Cohn: The Jews are in this War. In: The New Palestine, New York, 31. Jg., Nr. 4 vom 08. November 1940, S. 11.
Emil Moses Cohn: A Prophecy of 1896. In: The New Palestine, New York, 31. Jg., Nr. 15 vom 24. Januar 1941, S. 12.
Emil Moses Cohn: Yearning for Redemption. In: Congress Weekly. American Jewish Congress : a review of Jewish interests, New York, 8. Jg., Nr. 21 vom 30. Mai 1941, S. 9.
Emil Moses Cohn: Intelligence and Imagination. In: Congress Weekly. American Jewish Congress : a review of Jewish interests, New York, 9. Jg., Nr. 5 vom 30. Januar 1942, S. 7.
Emil Moses Cohn: Will We Ever Learn? In: The New Palestine, New York, 33. Jg., Nr. 6 vom 22. Januar 1943, S. 6.
Emil Bernhard Cohn: Letter to the Editor. In: Aufbau. An american Weekly published in New York = Reconstruction, New York City, 9. Jg., Nr. 16 vom 16. April 1943, S. 14.
Emil Moses Cohn: Los Angeles und die jüdische Immigration. In: Aufbau. An american Weekly published in New York = Reconstruction, New York City, 10. Jg., Nr. 49 vom 08. Dezember 1944, S. 15–16.
Emil Moses Cohn: Geschichten um Else Lasker-Schüler. In: Aufbau. An american Weekly published in New York = Reconstruction, New York City, 11. Jg., Nr. 6 vom 09. Februar 1945, S. 8.
Rezensionen
Emil Bernhard-Cohn: Die Haggadah des Kindes. In: Blätter des Jüdischen Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung, Berlin, 9. Jg., Nr. 4 vom April 1933, S. 1–2.
Abraham Moritz Silbermann (Hg.): Die Haggadah des Kindes. Übersetzt von Emil Moses Cohn. Berlin: Hebräischer Verlag Menorah 1933, 45 S.
Emil Bernhard Cohn: Eine neue deutsche Bibelübersetzung. In: Kulturbund Deutscher Juden Monatsblätter, Berlin, 2. Jg., Nr. 12 vom Dezember 1934, S. 1–3.
E. B. C. [d. i. Emil Moses Cohn]: Leo Hirsch, Praktische Judentumskunde. In: Jüdischer Kulturbund Berlin Monatsblätter, Berlin, 3. Jg., Nr. 11 vom November 1935, S. 12.
Leo Hirsch: Praktische Judentumskunde. Eine Einführung in die jüdische Wirklichkeit für jedermann. Berlin: Vortrupp Verlag 1935, 150 S.
Emil Bernhard Cohn: Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Verlag Erwin Löwe, Berlin. Eine Selbstanzeige. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 15.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Bücher der Klärung und des Wissens Bd. 1, Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 101 S.
Porträts und Nachrufe
Emil Moses Cohn: Herzl’s Successor. A Note on David Wolffsohn on the Occasion of the 25th Anniversary of His Death. In: The New Palestine, New York, 29. Jg., Nr. 29 vom 12. September 1939, S. 4.
Emil Moses Cohn: The Soul of Jehudah Halevi. In: The Menorah Journal, New York, 29. Jg., Nr. 2 1941, S. 141–162.
Emil Moses Cohn: In Memoriam Max Schloessinger. In: Aufbau. An american Weekly published in New York = Reconstruction, New York City, 10. Jg., Nr. 24 vom 16. Juni 1944, S. 26.
Weitere Sachtexte
Emil Cohn: Judentum. Ein Aufruf an die Zeit. München: Georg-Müller-Verlag 1923, 252 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Band II. Stand vom 31.12.1938. 1938, S. 21.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 1. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 78 S.
Emil Cohn: Anfängerfibel für Druck- und Schreibschrift zu Neuhebräisch schnell gelernt. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 12 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 2. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 41 S.
Emil Cohn: Anfängerfibel für Druck- und Schreibschrift zu Neuhebräisch schnell gelernt. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 12 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 2. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 41 S.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 49.
Emil Cohn: Anfängerfibel für Druck- und Schreibschrift zu Neuhebräisch schnell gelernt. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 12 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 2. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 41 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 1. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 78 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 1. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 78 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 2. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 41 S.
Emil Bernhard Cohn: Aufruf zum Judentum. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 251 S.
Dr. Hans Bach: Bücher eines Jahres. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 24. Jg., Nr. 33/34 vom 08. September 1934, S. 9–10.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 2. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 41 S.
Emil Cohn: Anfängerfibel für Druck- und Schreibschrift zu Neuhebräisch schnell gelernt. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 12 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 1. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 78 S.
Emil Cohn: Anfängerfibel für Druck- und Schreibschrift zu Neuhebräisch schnell gelernt. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1934, 12 S.
Emil Moses Cohn: Neuhebräisch schnell gelernt. Teil 1. Berlin: Siegfried Scholem Verlag 1933, 78 S.
Emil Bernhard Cohn: Das jüdische ABC. Ein Führer durch das jüdische Wissen. Herausgegeben von Emil Moses Cohn. 1. Aufl., illustriert von Joseph Avrach. Berlin: Erwin Löwe Verlag 1935, 336 S.
Hans Bach: Das jüdische ABC. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 14. Jg., Nr. 22 vom 30. Mai 1935, S. 9, 2. Beiblatt.
Emil Bernhard Cohn/Hans Bach: Das jüdische ABC. Eine Auseinandersetzung zwischen Herausgeber und Kritiker. In: C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, Berlin, 14. Jg., Nr. 23 vom 06. Juni 1935, S. 8.
Ohne Autor: Das jüdische ABC, ein Führer durch das jüdische Wissen, herausgegeben von Emil Bernhard Cohn. Verlag Erwin Löwe, Berlin. 1935. 336 Seiten. Geb. 4,60 RM. In: Mitteilungen der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin, Berlin, 18. Jg., Nr. 5 vom 15. Mai 1935, S. 77.
hs. [d. i. Hermann Sinsheimer]: Das jüdische ABC. Ein Führer durch das jüdische Wissen. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 20 vom 19. Mai 1935, S. 8.
L. W. [d. i. Lutz Weltmann]: „Das jüdische ABC.“ Ein Führer durch das jüdische Wissen. Herausgegeben von Emil Bernhard Cohn. 336 Seiten, 4,60 RM (Verlag Erwin Löwe, Berlin). In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 2. Jg., Nr. 1 vom Juni 1935, S. 10.
Dr. Lutz Weltmann: Jüdisches Leben und Lehren. Das jüdische Buch. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 24 vom 16. Juni 1935, S. 4.
W. [d. i. Robert Weltsch]: Ein jüdisches ABC-Buch. In: Jüdische Rundschau, Berlin, 40. Jg., Nr. 41 vom 21. Mai 1935, S. 10.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Berlin: Jüdische Buch-Vereinigung 1936, 99 S.
Emil Bernhard Cohn: Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Verlag Erwin Löwe, Berlin. Eine Selbstanzeige. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 15.
Ohne Autor: Das israelitische Prophetentum. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 25 vom 18. Juni 1936. Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Hans Oppenheimer: Lehren - Lernen - Lesen. Bemerkungen zu fünfzehn Büchern. Erschienen in 3 Teilen. In: Jüdischer Kulturbund Berlin Monatsblätter, Berlin, 4. Jg., Nr. 12 ff. ca. Dezember 1936/Februar 1937.
K. P. [d. i. Kurt Pinthus]: Ein Gang durch Jahrtausende. Emil Berhard Cohn: „Jüdische Geschichte.“ Verlag Erwin Löwe, Berlin. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 27 vom 05. Juli 1936, S. 12.
Joachim Prinz: Ein Weg in die jüdische Geschichte. „Die jüdische Geschichte“ von Emil Bernhard Cohn. Verlag Erwin Löwe, Berlin. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 38 vom 16. September 1936.
Dr. L. W. [d. i. Lutz Weltmann]: Zweimal Jüdische Geschichte. In: Der Schild. Herausgeber: Reichsbund jüdischer Frontsoldaten E.V., Berlin, 15. Jg., Nr. 32 vom 07. August 1936, S. 2.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Bücher der Klärung und des Wissens Bd. 1, Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 101 S.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Berlin: Jüdische Buch-Vereinigung 1936, 99 S.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Bücher der Klärung und des Wissens Bd. 1, Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 101 S.
Emil Bernhard Cohn: Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Verlag Erwin Löwe, Berlin. Eine Selbstanzeige. In: Blätter der Jüdischen Buchvereinigung, Berlin, 3. Jg., Nr. 2 vom September 1936, S. 15.
Ohne Autor: Das israelitische Prophetentum. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 25 vom 18. Juni 1936. Beilage „Jüdische Bibliothek“.
Hans Oppenheimer: Lehren - Lernen - Lesen. Bemerkungen zu fünfzehn Büchern. Erschienen in 3 Teilen. In: Jüdischer Kulturbund Berlin Monatsblätter, Berlin, 4. Jg., Nr. 12 ff. ca. Dezember 1936/Februar 1937.
K. P. [d. i. Kurt Pinthus]: Ein Gang durch Jahrtausende. Emil Berhard Cohn: „Jüdische Geschichte.“ Verlag Erwin Löwe, Berlin. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 26. Jg., Nr. 27 vom 05. Juli 1936, S. 12.
Joachim Prinz: Ein Weg in die jüdische Geschichte. „Die jüdische Geschichte“ von Emil Bernhard Cohn. Verlag Erwin Löwe, Berlin. In: Israelitisches Familienblatt, Berlin, 38. Jg., Nr. 38 vom 16. September 1936.
Dr. L. W. [d. i. Lutz Weltmann]: Zweimal Jüdische Geschichte. In: Der Schild. Herausgeber: Reichsbund jüdischer Frontsoldaten E.V., Berlin, 15. Jg., Nr. 32 vom 07. August 1936, S. 2.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Bücher der Klärung und des Wissens Bd. 1, Berlin: Erwin Löwe Verlag 1936, 101 S.
Emil Bernhard Cohn: Die jüdische Geschichte. Ein Gang durch Jahrtausende. Berlin: Jüdische Buch-Vereinigung 1936, 99 S.
Emil Bernhard Cohn: David Wolffsohn. Herzls Nachfolger. Amsterdam: Querido-Verlag 1939, 332 S.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 54.
Szenische Texte
Emil Bernhard: Der Brief des Uria. Ein Trauerspiel in fünf Akten. Bonn: Botenverlag 1919, 88 S.
Emil Bernhard: Jagd Gottes. Drama in 5 Akten. Berlin: Volksbühnen-Verl.- und Vertriebs GmbH 1925.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 48 f.
Emil Moses Cohn: The Panther. In: The Menorah Journal, New York, 30. Jg., Nr. 3 vom Juli 1942, S. 139–142.
Emil Bernhard/Vera I. Arlett: Four Jewish plays. Herausgegeben von Harold Frederick Rubinstein. Übersetzt von Berta Meyer (Berta Morena). London: Victor Gollancz Ltd. 1948, 303 S.
Übersetzungen
Abraham Moritz Silbermann (Hg.): Die Haggadah des Kindes. Übersetzt von Emil Moses Cohn. Berlin: Hebräischer Verlag Menorah 1933, 45 S.
Emil Bernhard-Cohn: Die Haggadah des Kindes. In: Blätter des Jüdischen Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung, Berlin, 9. Jg., Nr. 4 vom April 1933, S. 1–2.
Harry Torczyner (Naftali Hirts Tur-Sinai) (Hg.): Die Heilige Schrift. Neu ins Deutsche übertragen. Übersetzt von Emil Moses Cohn. Frankfurt am Main: J. Kauffmann Jüdischer Buchverlag und Buchvertrieb 1937, 1865 S.
J. Elbogen: Die Bibel in einem Bande. Die Heilige Schrift. Auf Veranlassung der Jüdischen Gemeinde Berlin herausgegeben von Harry Torczyner. Verlag J. Kauffmann, Frankfurt a. Main. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 27. Jg., Nr. 36 vom 05. September 1937, S. 11.
J. Elbogen: Die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Neu ins Deutsche übertragen. Vierter Band: Ketubim, Schrifttum. Verlag J. Kauffmann, Frankfurt a. 1937, 573 Seiten. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 20 vom 16. Mai 1937, S. 8.
I. Elbogen/I. Elbogen: Die heilige Schrift. Nebiim Rischonim Volksgeschichte. Frankfurt a. Main. J. Kauffmann Verlag. 1935. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 46 vom 17. November 1935, S. 5.
J. Elbogen: Die heilige Schrift. Neu ins Deutsche übertragen. Auf Veranlassung der Jüdischen Gemeinde Berlin herausgegeben von Harry Torczyner. Dritter Band: Nebiim Aharonim. Die Gottbegeisteten. Frankfurt, J. Kauffmann, 1936. 498 Seiten. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 27. Jg., Nr. 5 vom 31. Januar 1937, S. 4.
Ismar Elbogen: Neue Bibelübersetzung. In: Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Amtliches Organ des Gemeindevorstandes, Berlin, 25. Jg., Nr. 3 vom 20. Januar 1935, S. 5.
Dr. Lutz Weltmann: Die kritische Stimme. Das jüdische Leben im jüdischen Buch. In: Jüdisches Gemeindeblatt. Organ des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin, 27. Jg., Nr. 46 vom 14. November 1937, S. 4–5.
Emil Bernhard Cohn: David Wolffsohn. Herzl's successor. Philadelphia: Zionist Organization of America 1944, 281 S.
Emil Bernhard Cohn: David Wolffsohn. Herzls Nachfolger. Amsterdam: Querido-Verlag 1939, 332 S.
Emil Cohn: This immortal people. One hour of Jewish history. Übersetzt von Hayim Goren Perelmuter. New York: Behrman House 1945, 117 S.
Emil Bernhard/Vera I. Arlett: Four Jewish plays. Herausgegeben von Harold Frederick Rubinstein. Übersetzt von Berta Meyer (Berta Morena). London: Victor Gollancz Ltd. 1948, 303 S.
Emil Moses Cohn: The Marranos. A play in five acts. Übersetzt von Berta Meyer (Berta Morena). Später in: Harold Frederick Rubinstein (Hg.): Emil Bernhard/Vera I. Arlett. Four Jewish plays. Übersetzt von Berta Meyer (Berta Morena). London: Victor Gollancz Ltd. 1948, 303 S., S. 9–92.
Wissenschaftliche Arbeiten
Emil Moses Cohn: Der Wucher (Ribâ) in Quor'ân, Chadîth und Fiqh. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des muhammedanischen Rechtes. Berlin. 1903.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
REPRESSIONEN
Zwangsmitgliedschaften
Zensur
Aufführungsverbot durch Hans Hinkel in seiner Funktion als Reichskulturwalter (ab ca. 01.01.1933/01.09.1933)
Emil Bernhard: Jagd Gottes. Drama in 5 Akten. Berlin: Volksbühnen-Verl.- und Vertriebs GmbH 1925.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 48 f.
Verbot der Publikation „Judentum. Ein Aufruf an die Zeit“ (ab 31.12.1938)
Emil Cohn: Judentum. Ein Aufruf an die Zeit. München: Georg-Müller-Verlag 1923, 252 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Band II. Stand vom 31.12.1938. 1938, S. 21.
Inhaftierungen
Kurzzeitige Inhaftierung 1933 (am 02.04.1933)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 47.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Inhaftierung wg. Landesverrats (1935 – 10.1936)
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 9.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 52 f.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 50 f.
Georg, Karoline: Jüdische Häftlinge im Gestapogefängnis und Konzentrationslager Columbia-Haus 1933–1936. Berlin: Metropol Verlag 2021, S. 345 – 346.
UNTERSTÜTZUNG
Erfahrene Hilfe
Albert Einstein, Stephen Samuel Wise und Margot Ilius: Fürsprache
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136 f.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 51 f.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 55.
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Staatsangehörigkeit
USA (ab ca. 02.1939/12.1939)
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 55.
EMIGRATION
Emigration ab ca. 10.1936/02.1939
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 51 f.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 137.
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 55.
Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.): Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 2, Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871–1945, Bd. 1. Aaron – Kusznitzki. München: K. G. Saur 2009, S. 136 f.
NACHLASSMATERIALIEN
Nachlässe in anderen Archiven
SEKUNDÄRLITERATUR
Georg, Karoline: Jüdische Häftlinge im Gestapogefängnis und Konzentrationslager Columbia-Haus 1933–1936. Berlin: Metropol Verlag 2021, 546 S.
EHRUNGEN
Erinnerungsorte
Horner, Deborah: Emil Bernhard Cohn. Rabbi, Playwright and Poet. Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag 2009, S. 12.
Auszeichnungen
Drama-Preis der International Jewish Playwriting Competition (London) 1945
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 5. Carmo – Donat. München: K. G. Saur 1997, S. 209.