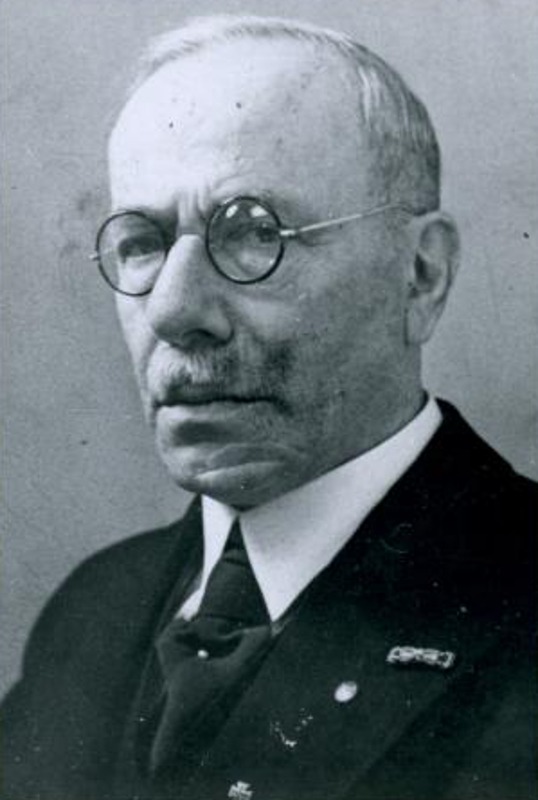Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
Georg, Karoline: Jüdische Häftlinge im Gestapogefängnis und Konzentrationslager Columbia-Haus 1933–1936. Berlin: Metropol Verlag 2021, S. 82.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 125.
Pseudonyme und Kürzel
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 125.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 701.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 1.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 1.
GEBURT
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
TOD
Naumann starb an Krebs.
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz
Berlich-Lichterfelde
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Freiburg (Militärarchiv)
Wiesentalstraße 10
79115 Freiburg
Ludwigsburg
Schorndorfer Straße 58
71638 Ludwigsburg
Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv)
Dr.-Franz-Straße 1
95445 Bayreuth
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 701.
FAMILIE
Ehe
Kinder
Eltern
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 122.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 122.
PERSÖNLICHES
Wohnorte
Westarpstraße 4, Berlin
Westarpstraße 4, Berlin-Schöneberg
Dahlmannstraße 3, Berlin-Charlottenburg
Ereignisse
Unfalltod der Tochter
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 170.
Krankheiten
Krebs
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 701.
BILDUNGSWEG
Schule
Friedrichs-Werdersches Gymnasium (Berlin) (bis 1893)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 127.
Studium
Jurastudium und Promotion (1893 – 1899)
MILITÄRISCHES
Kriegsteilnahme
Erster Weltkrieg
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 144 – 145.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 379.
ERWERBSLEBEN
Arbeitsverhältnisse
Herausgeber des „Nationaldeutschen Juden" (1922 – 1934)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 1.
Arbeit in der eigenen Anwaltskanzlei (bis 1935)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 701.
MITGLIEDSCHAFTEN
Burschenbund Brandenburgia (Berlin) (ab 12.1983)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 138 – 139.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 381 – 382.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 1.
KONTAKTE
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 16.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 42.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 575.
Prinz, Joachim: Joachim Prinz, Rebellious Rabbi. An Autobiography – the German and Early American Years. Herausgegeben von Meyer, Michael A.. Bloomington: Indiana University Press 2008, S. 100.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 254.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 585.
VERANSTALTUNGEN
Max Naumann: Die nationaldeutschen Juden nach dem 19. August 1934. Herausgegeben von Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ). Berlin: Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ) 1934, 14 S.
Naumann, Max: Die nationaldeutschen Juden nach dem 19. August 1934. Berlin: Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ) 1934.
WERKE
Artikel, Aufsätze, Essays
Dr. Max Naumann: Der Weg zum Deutschtum. Über das alteingesessene Judentum in Deutschland. In: Heinrich Mann (Hg.): Dr. Felix A. Theilhaber/Dr. Robert Weltsch/Prof. Dr. Ismar Elbogen/Arthur Holitscher/Lion Feuchtwanger/Heinrich Mann/Adolf Böhm/Felix Salten. Gegen die Phrase vom jüdischen Schädling. Prag: Amboss Verlag (Prag) 1933, S. 303–308.
Weitere Sachtexte
M. Naumann: Die Plessen. Stammfolge vom 13. – 20. Jahrhundert. Görlitz: Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke 1940, 183 S.
Vorträge
Max Naumann: Die nationaldeutschen Juden nach dem 19. August 1934. Herausgegeben von Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ). Berlin: Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ) 1934, 14 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 86.
REPRESSIONEN
Zwangsmitgliedschaften
Reichsschrifttumskammer (RSK) (bis 09.03.1935)
Zensur
Zensiertes Werk „Die nationaldeutschen Juden nach dem 19. August 1934“ (ab 25.04.1935)
Max Naumann: Die nationaldeutschen Juden nach dem 19. August 1934. Herausgegeben von Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ). Berlin: Verband Nationaldeutscher Juden (VnJ) 1934, 14 S.
Reichsschrifttumskammer (RSK) (Hg.): Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums. Gemäß § 1 der Anordnung des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer vom 25. April 1935 bearbeitet und herausgegeben von der Reichsschrifttumskammer. 1935, S. 86.
Erzwungene Kontakte zu NS-Behörden
Vorladung bei Hermann Göring (am 25.03.1933)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 589.
Inhaftierungen
Inhaftierung im Konzentrationslager Columbia-Haus und im Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße (18.11.1935 – 14.12.1935)
Schilde, Kurt/Tuchel, Johannes: Columbia-Haus. Berliner Konzentrationslager 1933–1936. Berlin: Ed. Hentrich 1990, S. 178.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 689.
UNTERSTÜTZUNG
Erfahrene Hilfe
Anna Naumann (geb. Lippmann): Sonstige (am 26.11.1935)
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 689.
EMIGRATION
Emigration
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, S. 701.
NACHLASSMATERIALIEN
Nachlässe in anderen Archiven
SEKUNDÄRLITERATUR
Georg, Karoline: Jüdische Häftlinge im Gestapogefängnis und Konzentrationslager Columbia-Haus 1933–1936. Berlin: Metropol Verlag 2021, 546 S.
Hambrock, Matthias: Die Etablierung der Außenseiter. Der Verband nationaldeutscher Juden 1921–1935. Köln, Weimar und Berlin: Böhlau Verlag 2003, 864 S.
Schilde, Kurt/Tuchel, Johannes: Columbia-Haus. Berliner Konzentrationslager 1933–1936. Berlin: Ed. Hentrich 1990.
Biografische Texte
E. R.-J. [d. i. Eva Gabriele Reichmann]: Max Naumanns Irrweg. In: C.V.-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum, Berlin, 12. Jg., Nr. 34 vom 07. September 1933, S. 9, 2. Beilage.
EHRUNGEN
Auszeichnungen
Bayerischer Militärverdienstorden 4. Klasse
Eisernes Kreuz 1. Klasse
Eisernes Kreuz 2. Klasse
Willi, Jost Nikolaus: Der Fall Jacob-Wesemann (1935/1936). Ein Beitrag zur Geschichte der Schweiz in der Zwischenkriegszeit. Bern: Peter Lang GmbH 1972, S. 14-15.
Heuer, Renate (Hg.): Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Bd. 18. Phil – Samu. Berlin und Boston: De Gruyter 2010, S. 474.